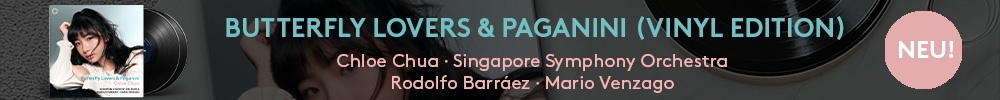Pizzicato-Mitarbeiter Alain Steffen hat sich mit der ungarisch-schweizerischen Pianistin Andrea Kauten unterhalten.
Sie haben an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest studiert, die für ihren ganz besonderen Spielstil bekannt ist. Inwiefern hat dieser Stil Ihre Interpretationen geprägt? Und wie könnte man ihn definieren?
Ich will einmal so anfangen: Ein wesentlicher Teil meiner Ausbildungszeit fand in Budapest statt und zwar genau in jener Zeit meiner persönlichen Entwicklung, in der ich besonders aufnahmefähig war. Die Art und Weise, wie man dort an die Musik heranging, beeinflusst mein Spiel bis heute. Aber auch der Austausch mit den Musikerkollegen und die ganze Atmosphäre in Budapest waren einfach einmalig. Bei der Erarbeitung eines Werkes wurde der Hauptpunkt immer auf die Emotionalität und die Intensität gelegt, das Musikantische blieb stets im Vordergrund. Ich hatte ja vorher in Basel studiert und bin dann zur Solistenausbildung nach Budapest gegangen. Das war etwas komplett anderes, als alles, was ich von Basel her gewohnt war. Das Ausloten der Werke und der Musik wurde immer in den Mittelpunkt gestellt, technische Fragen waren eigentlich zweitrangig. Spieltechnische Probleme wurden nicht rein als technische Probleme angesehen, sondern sie wurden immer im musikalischen Kontext betrachtet. Was will der Komponist dann sagen, was passiert, wo ist die Melodie, welche Hand führt? Das nimmt dann schon sehr viel Druck weg, weil man sich nicht mehr mit dem technischen Umsetzen eines problematischen Fingersatzes beschäftigt, sondern viel eher versucht, diese Stelle musikantisch und organisch zu lösen und sie in den Kontext des Musikflusses zu setzen. Und hat man das einmal begriffen und verinnerlicht, dann lösen sich viele sogenannten technische Probleme ganz von selbst.
Vor Budapest und Basel haben Sie ja auch einige Musikwettbewerbe gewonnen. Kunst und Wettbewerb, geht das eigentlich zusammen? Und wie wichtig sind Wettbewerbe tatsächlich für einen Musiker?
Ich muss ehrlich sagen, meine Einstellung zu Wettbewerben ist im Nachhinein eher skeptisch. Ich war nie eine überzeugte Wettbewerbs-Teilnehmerin; auch während meiner Studienzeit habe ich Wettbewerbe gemieden. Der Musiker ist dort quasi nur eine Nummer. Aber für eine Karriere kann ein Wettbewerb sehr entscheidend sein. Es geht, wenn man Glück hat, alles viel schneller vorwärts. Ich habe aber bei mir selbst gemerkt, Wettbewerbe sind nicht meine Welt. Durch diesen Druck geht bei mir die Kreativität verloren und ich kann die musikalische Botschaft dann nicht so ausdrücken, wie ich das gerne möchte. Ich habe dann auch keinen Wettbewerb mehr gemacht und im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Karriere viel langsamer voranschreitet.
Wettbewerbe sind ja auch eng mit dem Musikbetrieb verbunden. Neue, schöne Talente werden entdeckt und von den sogenannten Majors quasi ausgeblutet.
Jeder Künstler und jede Karriere ist ja etwas sehr Individuelles. Es ist schade, dass heute nur noch ein Karrieremuster akzeptiert und sehr viel Wert auf gutes Aussehen und eine Mainstream-Karriere gelegt wird. Da geht sehr viel Inhalt verloren, und die Karriere dieser jungen Musiker wird oft durch die Nachfrage auf dem Markt bestimmt. Die Majors wollen ja möglichst viel Geld durch ihre Künstler verdienen. Und das funktioniert nicht ohne eine geschickte PR- und Marketing-Strategie.
Viel wichtiger wäre es, jeden Künstler als einzigartiges Individuum zu betrachten und sich zu fragen: Was hat dieser Musiker zu sagen, was will er mit seiner Interpretation ausdrücken, wohin zeigt sein Weg?
Sie sind bei einer Major-Firma unter Vertrag und können trotzdem bei Ihren Aufnahmen unkonventionelle Programme zusammenstellen, wie das bei Ihrer Doppel-CD mit Werken von Franz Liszt der Fall ist.
(lacht) Wenn man aus einem bestimmen Alter heraus ist, werden andere Aspekte wichtiger. Reife Musikerpersönlichkeiten bleiben natürlich auch für Major-Firmen immer noch interessant, es ist ja nicht so, dass diese nur auf junge Stars setzen. Nicht umsonst können die Firmen mit Pianisten wie Rubinstein, Brendel oder Argerich immer noch gute Umsätze machen. Das sind Interpreten von Weltrang und das zahlt sich für die Firmen immer noch aus.
Kommen wir doch kurz auf Ihre rezente Liszt Doppel-CD zu sprechen, wo Sie auch relativ selten gespielte Werke wie ‘Malédiction’ oder ‘Totentanz’ aufgenommen haben.
Für mich ist es sehr wichtig, die Musik von Franz Liszt von ihren gängigen Klischees zu befreien. Liszt war beileibe nicht nur der Techniker und Tastenvirtuose, sondern da ist sehr viel Intensität, Expressivität und Dramatik in seiner Musik. Deshalb ist es bei einer CD-Produktion für mich auch sehr wichtig, dass ich konzeptuell vorgehen und die CD quasi als ein abgerundetes Projekt gestalten kann. Ich kann mich daher glücklich schätzen, dass meine Produktionsfirma mir viele Freiheiten lässt. Als ich dieses Liszt-Projekt angegangen bin – eine erste CD mit u.a. der h-Moll Sonate ist im letzten Jahr erschienen – war es mir sehr wichtig, gerade die ‘Malédiction’ aufzunehmen, weil dieses Werk des vierzehnjährigen Liszt schon absolut ausgereift ist. Was wiederum die kompositorischen Fähigkeiten dieses Komponisten unterstreicht. Vieles, was wir dort an musikalischen Ideen antreffen, findet sich auch in seinen reiferen Werken wieder. Ein Techniker alleine kann dieses Werk nur unzureichend spielen, denn Liszt verlangt hier sehr viel Dramatik, Aussagekraft und Musikalität. Und da in ‘Malédiction“’ das Thema Tod vorkommt – Liszt nimmt hier bereits das Dante-Motiv seiner späteren Sonate vorweg – lag es naheliegend, ein Programm mit diesem Schwerpunkt anzustreben. Und da Liebe ebenfalls ein Thema der ‘Malédiction’ ist, war für mich das Motto für die CD, nämlich ‘Liszt, die Liebe und der Tod’ schnell gefunden. Sämtliche Werke dieser Aufnahme haben einen Bezug zu diesem Motto, selbst die ‘Ungarische Fantasie’ für Klavier und Orchester, die Liszts Liebe zu seinem Vaterland wiedergespiegelt. Für mich war Liszt ganz deutlich ein Ungar und nicht ein Österreicher oder Franzose. Seine Musik spricht hier eine sehr klare Sprache. Das ist kein ungarischer Kitsch, sondern wirklich ein tiefempfundener ungarischer Pathos. Auch die Diktion in seiner Musik entspricht hundertprozentig der ungarischen Sprache. Genau wie die ‘Ungarische Rhapsodie’. Und ‘Totentanz’ spricht ja bereits durch seinen Titel für sich.
Und die ‘Années de Pèlerinage’?
Ebenfalls! Jedes der Italien-Stücke aus dem zweiten Jahr ‘Années de Pèlerinage’ hat einen Bezug zur Liebe oder zum Tod, insbesondere natürlich ‘Après une lecture de Dante’“. Und hier erweist sich Liszt als ein sehr belesener Musiker, denn in seinen ‘Années’ vertont er quasi ausschließlich literarische Vorlagen, was dem Bild des oberflächlichen Tastenlöwen wiederum sehr deutlich wiederspricht.
Ein anderer Komponist, der ihnen sehr nahe steht ist Robert Schumann. Spürt man eigentlich in seinen Werken eine Auswirkung seiner psychischen Krankheit?
Über Schumanns psychische Krankheit wird nach wie vor spekuliert und man ist sich noch immer nicht hundertprozentig sicher, ob Schumann wirklich psychisch krank war. Und wenn ja, in welchem Maße. Vieles deutet darauf hin, dass seine Frau Clara ihn zum Schluss gar nicht mehr aus der psychiatrischen Anstalt in Endenich herausholen wollte, weil sie lieber mit Johannes Brahms eine Beziehung leben wollte. Sicher ist jedoch, dass Schumann ein hochsensibler Mensch war und sehr viel aus dieser Sensibilität heraus reflektiert. Für mich ist seine Musik immer einleuchtend und nachvollziehbar. Sicher, da gibt es Brüche und Stimmungen, die auf eine mögliche Erkrankung hindeuten. Aber in seiner Musik ist Schumann immer logisch und konsequent. Schumanns Musik ist immer sehr nach innengekehrt, sehr introspektiv und intim. Liszt dagegen entwickelt seine Kompositionen eher aus literarischen Vorlagen heraus. In dem Sinne spiegelt Schumanns Musik seine emotionalen Regungen oder seinen Gemütszustand wieder. Aber nicht nur. Schumann war ein sehr kritischer Geist, der auch aktuelle Themen seiner Zeit zitiert.
Schumann war ja ein typischer Komponist der Romantik, mit einer, wie Sie sagen, sehr introvertierten und introspektiven Arbeitsweise. Worin unterscheidet sich der musikalische Ausdruck eines romantischen Komponisten wie Schumann von dem eines klassischen wie beispielsweise Beethoven?
In der Klassik war alles viel mehr noch an eine strikte Form gebunden. Die Aufgabe des Komponisten war es, seine Ideen oder eben Gefühle in diese vorgegeben Form und nach festgelegten Regeln einzubinden und zu verarbeiten. Mit dem Auflösen dieser strikten Formen entsteht natürlich auch etwas mehr Raum für neue Impulse. Dadurch hat sich dann eine neue Gefühlspalette in der Romantik ergeben. Wobei ich der Klassik keineswegs die Intensität und die Dramatik absprechen will, Beethoven hat unwahrscheinlich intensive Musik geschrieben, denken Sie nur an seine letzten Klaviersonaten und Streichquartette. Jedoch ist dieses Intensive eben anders konzipiert. Sie ist durch die Form greifbarer und übersichtlicher. Allerdings nimmt man das als Hörer meistens gar nicht so deutlich wahr, weil wir die Musik hauptsächlich als etwas Emotionales erleben. Und das gilt für alle Epochen der Musikgeschichte, sei es nun Renaissance sei es zeitgenössische Musik. Zeitgenössische Werke, die in erster Linie mathematisch angelegt sind, sprechen den Hörer weit weniger an, als moderne Musik, die den Emotionen Raum lässt.
Als Konzertpianistin müssen Sie ja immer wieder auf anderen Flügeln mit anderen Charakteristika und Klangfarben spielen. In wieweit beeinflusst diese Tatsache die Interpretation und Ihre eigenen Klangvorstellungen von dem Werk, das Sie in dem Moment aufführen müssen?
Sie sprechen da die ganz große Problematik eines jeden Pianisten an. Wir beneiden ja wirklich die Violinisten und Cellisten, die ihr eigenes Instrument mitbringen können. Obwohl, dieses Instrument ist auch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsproblemen unterworfen. Als Pianisten haben wir leider immer wieder das Problem, dass wir oft auf mittelmäßigen Klavieren spielen müssen, die nicht gut klingen oder eine sehr eingeschränkte dynamische Bandbreite haben. Wir dürfen uns nicht auf einen ganz spezifischen Klang einstellen, besonders nicht, wenn wir auf einer Tournee sind. Bei einer CD-Aufnahme im Studio ist das anders, nicht aber im Konzert. Als Interpret muss ich immer flexibel sein und mein Spiel, meine Interpretation dem Moment und dem Instrument anpassen können. Ich muss die gegebenen Umstände einfach bestmöglich nutzen können. Während des Konzertes treten diese Probleme allerdings in den Hintergrund. Da ist man auf das Wesentliche konzentriert, nämlich den besten Zugang zur Musik zu finden.
An dieser Stelle möchte ich aber auch noch auf etwas Anderes eingehen. Auf den Kontakt zum Publikum. Sie hören sicherlich oft in Gesprächen, wie wichtig dieser direkte Kontakt ist. Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist die Konzertsituation, jetzt unabhängig vom Instrument, ein Balanceakt. Die Situation setzt sich für mich aus zwei Komponenten zusammen. In erster Linie steht das geschriebene Werk, das im Konzert ja noch einmal emotional nachvollzogen werden soll. Und dann ist da zweitens das Eintauchen in die Musik. Dies ist der allerwichtigste Faktor für ein gelungenes Konzert. Erst dann, wenn ich mich hundertprozentig in die Musik fallen lasse und versuche, alle Emotionen offenzulegen, erst dann geschieht diese Wechselwirkung mit dem Publikum. Erst in dem Moment, wo ich aktiv werde, beginnt die Musik zu leben und berührt das Publikum. Erst dann ist der Kontakt da. Wenn man von vorne herein versucht, das Publikum bewusst zu beeindrucken und zu verführen, wie das leider viel zu viele Musiker tun, weil es von ihnen verlangt wird, geht dies auf lange Dauer auf die Kosten der Musik selbst.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass gerade diese Form von Kontakt, die Sie beschreiben, durch den Musikbetrieb nach und nach verfälscht wird. Man geht nicht mehr in ein Konzert, um ein Werk zu hören, sondern vielmehr, um einen großen Star zu erleben.
Leider ist das so. Vor lauter PR, Karriereplanung und Show geht diese Form von Musikvermittlung etwas verloren. Das Publikum tut sich immer schwerer, sich für das zu öffnen, was im Moment eines Konzertes passiert. Es fokussiert heute viel zu sehr den Künstler und dessen vom Marketing geschickt aufgebaute Aura. Musik ist etwas Organisches, und das müssen die Leute im Konzertsaal wieder lernen. Musik lebt, hat einen eigenen Lebensrhythmus, ein eigenes Herz. Und wenn da ein Künstler kommt, und sich durch eigenwillige Tempomodifikationen interessant machen will, dann bekommt die Musik Herzrhythmusstörungen und folgt nicht mehr ihrem inneren Fluss. Glücklicherweise entziehen sich auch bekannte Musiker wie Lars Vogt oder Jan Vogler immer mehr dem Öffentlichkeitsdruck und gründen eigene, kleine Festivals, wo sie im Umgang mit der Musik während einiger Wochen wieder viel freier sind und sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Ist das auch der Grund, warum Sie die künstlerische Leitung einer Konzertserie übernommen haben?
Unter anderem. Wir sehen uns als eine kleine, aber feine Konzertreihe, bei der die Musik ganz im Mittelpunkt steht. Klassik im Krafft-Areal ist 2006 entstanden. Ich habe die künstlerische Leitung übernommen, weil ich hier die Möglichkeit hatte, etwas aufzubauen, mit dem wir von dem konventionellen Musikbetrieb etwas wegkommen konnten. Bei den Engagements ziehe ich bewusst reifere Künstler vor, die eine ähnliche Auffassung von der Musik haben, wie ich und die sich dem ganzen Starsystem entziehen wollen. Diese Musiker bringen alle eine gewisse Lebenserfahrung mit, die für den Inhalt und die Vermittlung der Musik sehr wichtig ist. Die Konzerte finden in einem alten, aber renovierten Industriekomplex der Jahrhundertwende statt, der unter Denkmalschutz steht, sich aber hervorragend für unsere Absichten ereignet. Die Konzerte finden in einem eher rustikalen Industrie-Ambiente statt, die sich auf Publikum und Musiker ganz anders auswirkt, als in der doch sonst steifen, noblen Konzertatmosphäre.
Was ist denn so für Sie das wichtigste Ziel, das Sie mit Klassik im Krafft-Areal erreichen wollen?
Eigentlich eine ganz einfache. Zu allererst die Musik! Der Zuhörer soll wieder in allererster Linie der Musik und nicht dem Interpreten zuhören.