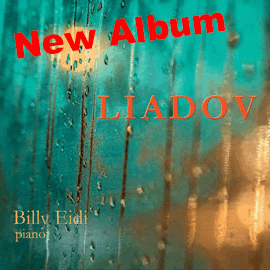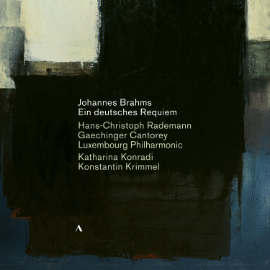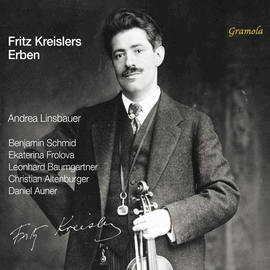Bei Ihrer rezenten Aufnahme von Robert Schumanns Cellokonzert haben Sie sich als Begleiter die Camerata Salzburg ausgewählt, also ein Kammerorchester. Ist das Cellokonzert denn großangelegte Kammermusik?
Schumanns Cellokonzert ist kein heroisches Werk wie beispielsweise das Dvorak-Konzert. Und es kommt ohne einen wirklichen symphonischen Klang aus. In dem Sinne kann man dieses Stück, was ja quasi nur in einem langsamen Satz komponiert ist, als ein sehr intimes Werk Schumanns bezeichnen. Natürlich gibt es drei Sätze, aber die gehen ohne Pause ineinander über. Schumann hat sein Konzert zuerst auch als Konzertstück bezeichnet, und erst später dann als Cellokonzert. Es ist relativ klein geschrieben, und immer wenn das Cello spielt, ist die Begleitung sehr zart und fein. Darüber hinaus gibt es sehr viel Dialogstellen zwischen dem Soloinstrument und dem Orchester. Diese Dialoge sind eigentlich ein Weiterdenken von Kammermusik. Tatsächlich ist es auch dieser kammermusikalische Charakter, der das Werk auszeichnet. Für mich war es daher ideal, Schumanns Cellokonzert mit einem Kammerorchester wie der Camerata Salzburg aufzunehmen. Und zwar ohne Dirigent, denn so müssen alle Musiker aufeinander hören und gemeinsam agieren; die Musik zwischen allen Musikern entwickelt sich demnach viel mehr im Geiste der Kammermusik.
Das Cellokonzert wurde ja relativ spät komponiert. Kurz danach gab es den Selbstmordversuch und die anschließende Internierung in Endenich. Gibt es in dieser Musik Hinweise auf den psychischen Verfall Schumanns?
Schwer zu sagen. Wenn man die Briefe von Clara Schumann liest, so stellt man fest, dass Schumann sehr oft nachts an dem Konzert gearbeitet hat oder spontan noch Änderungen vorgenommen hat. Diese Schlaflosigkeit und diese innere Unruhe können sicherlich als Vorzeichen seiner psychischen Erkrankung angesehen werden. Es war kein rein ruhiger oder entspannter Kompositionsprozess. Dieses Fiebrige, Getriebene hört man besonders gut in der Durchführung des 1. Satzes, wo es sehr viele akute Stimmungswechsel gibt. Es geht sehr schnell von stürmisch zu Tode betrübt, von laut zu leise. Und das passiert alles sehr, sehr schnell so dass man gerade hier eine wirkliche Hinundhergerissenheit aus der Musik heraushören kann. Da kann man dann diesen Florian-Eusebius-Wechsel aus sehr gut bemerken. Der letzte Satz ist dann dagegen sehr friedsam, ja sogar freudig, das spürt man dieses bipolare Element dann wieder gar nicht.
Hat sich die Schumann-Rezeption im Laufe des letzten halben Jahrhunderts wesentlich verändert?
Schwer zu beantworten. Ich denke, Schumann hat heute seinen festen Platz im Repertoire gefunden, seine Musik wird nicht mehr belächelt, sondern er wird heute als der wohl romantischste Komponist seiner Zeit geschätzt und geliebt. Keiner hat den romantischen Geist so gut eingefangen, wie Robert Schumann. Alles kommt bei ihm von der Poesie her. Und bei kaum einem anderen Lied-Komponisten passen Text und Musik so hervorragend zusammen.
In Luxemburg beginnen Sie Ihre Klavierquartett-Tournee mit anderen renommierten Kollegen, die allesamt großartige Solisten sind. Ist dies jetzt ein festes Ensemble?
Ja und nein. Also wir machen einmal im Jahr zusammen eine Tournee. Und die ist eigentlich dann auch sehr kurz, also länger als zwei Wochen spielen wir nicht zusammen. Und den Rest des Jahres verfolgt jeder von uns seine Solokarriere. Wir kennen uns aber sehr gut und spielen schon seit Jahren mit den gleichen Leuten. Wir haben eine sehr gute Beziehung zueinander, auf der Bühne, aber auch privat vertragen wir uns sehr gut. Wir haben viel Spaß zusammen und einmal im Jahr fließt dann all dieses Positive zusammen in unserer Tournee.
In wieweit spielen die Erkenntnisse der historischen Aufführungspraxis eine Rolle für Sie?
Ich bin natürlich daran interessiert, aber für mich ist es wichtig, wenn ich Bach oder Boccherini aufführe, dass ich sehr natürlich spiele. Also nicht so sehr intellektuell, eher aus dem Bauch heraus. Ich sehe keinen Sinn für mich darin etwas so oder so zu spielen, nur weil es in einem Buch steht. Die Musik muss atmen, muss leben und vor allem, sie Muss Sinn machen, für heute und für mich als Person. Die Stimmung ist ein wichtiger Punkt. Heute werden die Orchester alle auf einem A 442 Herz oder 440 Herz gestimmt, früher waren die Stimmungen nicht so gefestigt und oft auch tiefer gestimmt, auf A 415. Das hat einen immensen Einfluss auf die Klangfarbe und da experimentiere ich schon ganz gerne. Nächste Woche beispielsweise spiele ich die Bach-Sonaten auf A 415, weil ich finde, dass Bachs Musik auf dieser Frequenz am besten atmet. In dem Falle ist es meine persönliche Überzeugung und mein eigenes Klangempfinden. Ich habe auch gemerkt, dass mein Stradivari-Cello bei dieser Stimmung am besten schwingt. Und ich habe das Gefühl, dass Bach wahrscheinlich diesen Klang im Kopf hatte, weil er absolut natürlich ist und die Instrumente damals auch so gestimmt wurden. Auch die Bogenführung spielt eine Rolle. Ich spiele Bach mit meinem Bogen stilistisch ganz anders als wenn ich jetzt Brahms oder Strauss. Jeder Komponist hat seine eigene Atmung. Man muss einfach der Musik vertrauen und sich ihr anpassen. Die Musik selbst sagt uns ganz genau, wie wir sie spielen müssen.
Ich hatte 2018 Ihr Konzert beim Lucerne Festival gehört, als Sie den Credit Suisse Young Artist Award erhalten hatten und so mit den Wiener Philharmonikern unter Franz Welser Möst aufgetreten durften und das Dvorak-Konzert gespielt hatten . Danach ging es dann mit Ihrer Karriere recht schnell bergauf. Ist man da als junger Musiker nicht plötzlich überfordert?
Ich denke, das war alles sehr organisch bei mir. Nichts ist plötzlich passiert. Zum Glück hat sich das alles in meinem Leben sehr langsam und kontinuierlich entwickelt. Beginnend 2013, als ich einen Wettbewerb gewonnen hatte bis eben 2018, wo dann der richtige Durchbruch kam. Das hat sich dann über diese 6 Jahre sehr langsam und vor allem sehr natürlich aufgebaut. Dass ich einen vollen Kalender mit Toporchestern hatte, das kam nicht von heute auf morgen. So konnte ich mich langsam entwicjkeln, und auch langsam auf das vorbereiten, was man Karriere nennt. Andere hatten nicht das Glück und mussten quasi über Nacht in eine internationale Karriere hineinspringen, was dann tatsächlich sehr gefährlich ist.
Inmitten dieser doch sehr wichtigen Anfangsjahre kam die Corona-Krise. Wie war das für Sie und wie sind Sie damit umgegangen?
Ich hatte das Glück, dass ich kurz vor Corona schon ein bisschen ‘arriviert’ war, vieles war bereits gefestigt, hatte eingeplante Konzerte und ich hatte einige sehr gute Beziehungen zu verschiedenen Orchestern, Veranstaltern und Konzerthäusern. Schwierig war es vor allem für die jüngeren, die noch nicht gefestigt waren oder kurz vor dem Beginn ihrer Karriere standen und noch keine wirklichen Beziehungen und Engagements hatten.
Wie hilfreich ist es, als junger Künstler bei einem renommierten Label wie Deutsche Grammophon unter Vertrag zu sein?
(lacht) Natürlich hat das Vorteile, wenn man bei Deutsche Grammophon unter Vertrag ist. Es gibt ein gewisses Prestige. Wenn Veranstalter dieses gelbe Etikett sehen, ist es wie ein Gütesiegel, quasi eine Garantie für einen erstklassigen Künstler. Und das öffnet natürlich schneller gewisse Türen und wirkt sich positiv auf die Engagements aus. Am Ende aber müssen der Künstler und die Musik für sich selber sprechen. Wenn die Latte hochgelegt ist und man die Erwartungen nicht erfüllt, kann das schon bitter werden. Das Einzige was zählt, das ist die Leistung auf der Bühne. Wenn die nicht stimmt, dann kann weder ein Label noch eine Agentur helfen.
Haben Aufnahmen bei solchen Labels eigentlich noch den gleichen Impact wie vor 30 Jahren?
Nein, nicht mehr. Vor 30 Jahren waren die CDs quasi die einzige Möglichkeit, wie man Musik konsumieren konnte. Es wurde eine Aufnahme gemacht und jeder wollte sie hören. Viel wichtiger war die Zeit vorher, da wurden verschiedene Werke zu ersten Mal aufgenommen und die einzige Möglichkeit, diese Musik zu hören, war auf CD resp. auf LP. Heute gibt es von jedem Werk mindestens 20 Interpretationen, Spotify, Apple music und andere Streamingdienste bieten alles an, was man gerne hören möchte. Und trotzdem: ich finde es nach wie vor wichtig, Aufnahmen zu machen und so auch weiterhin neue Interpretationen und neue Aspekte entdecken zu können. Was sich verändert hat, das sind die Alben. Sie haben heute einen anderen Spirit als früher. Heute reicht es nicht mehr, dieses oder jenes Werk aufzunehmen, heute sollte ein Album ein Konzept sein, eine gewisse Stimmung einfangen und auf Bezüge hinweisen. Alben haben heute mehr einen Projekt-Charakter. Mein letztes Schumann-Album enthält neben dem Cellokonzert dann auch noch und ermöglicht dem Hörer quasi eine dreidimensionale Sichtweise auf Schumann. Man kann das Album in einem Zug durchhören und es hat einen organischen Fluss. Ein gutes Album soll eine gute Playlist sein, die Sinn macht (lacht).