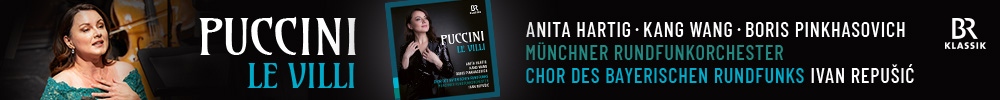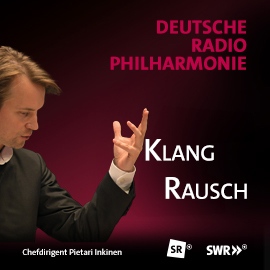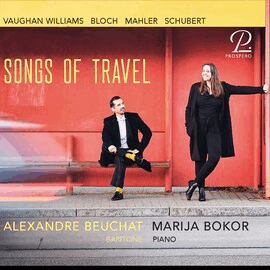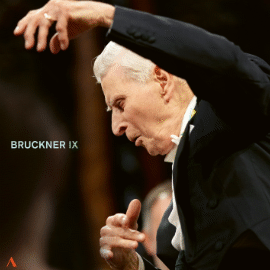In Anlehnung an Beethovens Neunte Sinfonie schuf Ferruccio Busoni in den Jahren 1903 und 1904 sein Konzert für Klavier und Orchester mit – was bisher einmalig war – einem Chorfinale für Männerstimmen. Das Werk Busonis, der in Leipzig studiert und gelehrt hatte, erklang jetzt erstmals mit Gewandhausorchester. Michael Oehme berichtet.
Was für Gustav Mahlers Achte, die Sinfonie der Tausend (Uraufführung 1910) oder Arnold Schönbergs überdimensionierte Gurre-Lieder (1913) gilt, soll aus dieser Zeit bei Ferruccio Busoni sein Konzert für Klavier, Chor und Orchester gewesen sein – ein fünfsätziges Monstrum von 75 Minuten Dauer mit einem Schlusssatz à la Beethoven für Männerstimmen. Völlig falsch dieses Vorurteil, aus Unkenntnis dieses nur selten zu hörenden Werkes. Busonis op. 39 ist, abgesehen von seiner Länge und dem einmaligen Chorfinale in einem Solokonzert, ein durch und durch spätromantisches Klavierkonzert zwischen Liszt, Brahms und noch vor Rachmaninov, keineswegs modern, uraufgeführt 1904 vom Komponisten selbst als Solisten in Berlin mit den Philharmonikern unter Karl Muck. Man bedenke, nur ein Jahr später wurde in Dresden Richard Strauss`revolutionäre Salome aus der Taufe gehoben!
Mit geradezu Mendelssohnscher Wärme beginnt das Werk und lässt im Verlauf zunehmend benannte Rachmaninovsche Züge vorausahnen. Nur zögerlich setzt der Solopart ein, um sich dann – schon der Länge des Werks wegen- fast übermenschlichen pianistischen wie musikalischen Anforderungen auszusetzen. Igor Levit meistert diese Aufgabe bewundernswert und souverän. Antonio Pappano am Pult des Gewandhausorchester ist ihm dabei faszinierender Begleiter. Seine, eine heutzutage eher selten anzutreffende ästhetische Dirigiertechnik – welch Zauber geht von seiner rechten Hand aus! – entlockt dem Orchester schönste Farben und starke Momente. Da ist das diabolische Scherzo, das leidenschaftliche Sommessamente im dritten Satz oder die naturgemäß wilde Tarantella, die alle aus der Schatzkiste der Musik des 19. Jahrhunderts schöpfen. Interessant die Dialoge zwischen Klaviersolist und den Chören der Holz- oder Blechbläser, teils unisono, hymnisch und volksliedhaft. Das Gewandhausorchester spielt die ihnen bisher unbekannte Musik (es gab in Leipzig bisher nur mit dem Rundfunksinfonieorchester eine Aufführung des Stücks) mit spürbarer Musizierfreude und Brillanz. Im Verlaufe des abendfüllenden Werks sind es nur wenige Momente, in denen der Klavierpart im Orchesterrausch untergeht.
Schließlich der Schlussatz Cantico mit Männerchor, die Vertonung eines Textes von Adam Gottlob Oehlenschläger aus dem Jahr 1808 nach Aladdin und die Wunderlampe. Allah ist hier jener, der den Herzen Kraft gibt und sie erglühen lässt. Der Vergleich zum hymnischen Schluss in Beethovens Neunter ist jedoch fern, der Chorsatz eher schlicht berührend und mehr an Brahms` Alt-Rhapsodie erinnernd. Die Herren des MDR Rundfunkchors (Einstudierung Justus Barleben) und des GewandhausChores (Einstudierung Theresa Heidler) singen ihn mit bestechender Klarheit und Klangschönheit, ohne falsches Pathos. Der Klaviersolist tritt dabei noch einmal zurück, um dann in eine grandiose Schlusskadenz einzumünden. Levit und Pappano, die mit dessen Santa Cecilia Orchester in Rom Busonis Opus magnum schon mehrfach erprobt hatten, liegen sich danach länger als üblich in den Armen. Der Jubel an drei bis auf den letzten Platz besetzten Abenden im Gewandhaus wurde vom Publikum stehend vorgetragen.