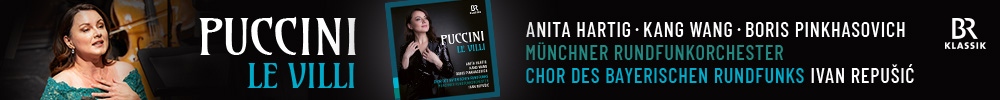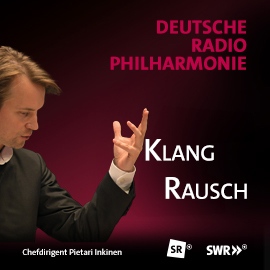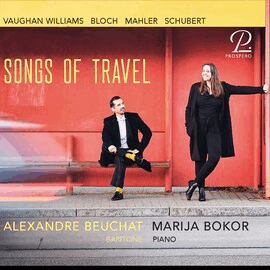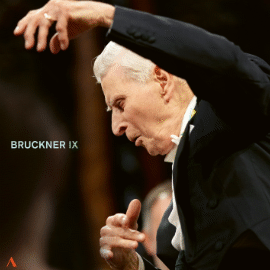Vor 80 Jahren, am 13. Februar 1945 wurden die Stadt Dresden und damit auch die Semperoper von anglo-amerikanischen Bombern in Schutt und Asche gelegt. 1985, 40 Jahre später und damit heute vor 40 Jahren konnte das wiederaufgebaute Opernhaus eingeweiht werden – zwei Daten des Erinnerns, dessen mit Giuseppe Verdis Messa da Requiem gedacht wurde. Michael Oehme berichtet.
Schon sechs Jahre nach Kriegsende, 1951, begründete Rudolf Kempe die Tradition, mit der Staatskapelle Dresden alljährlich am 13. Februar eine der großen Requiem-Vertonungen aufzuführen. Als erstes damals war es Giuseppe Verdis Messa da Requiem, die seitdem neben den entsprechenden Werken von Mozart, Brahms, Berlioz, Dvorák, Britten und anderen am häufigsten immer wieder auf dem Programm stand.
Daniele Gatti hatte bereits 2005 eine Aufführung von Verdis Totenmesse in Dresden geleitet. Jetzt, in seiner ersten Spielzeit als neuer Chefdirigent der Staatskapelle, war von dem in Mailand geborenen Italiener wieder eine authentische Interpretation zu erwarten.
Sparsam mit den Händen formt der Maestro die Musik, lässt Chor und Orchester im Requiem aeternam aus dem Nichts kommen und das Solistenquartett erstmals aufblühen lassen. Mit energischer Gestik, erschütternd dann das Dies Irae, in dem der an Holz erinnernde Boden geradezu bebt – die tiefen Streicher, Fagotte und Klarinetten der Kapelle brodeln, die Trompeten und Posaunen des Jüngsten Gerichts – im Raum verteilt – schmettern, aber auch im äußersten Fortissimo noch auf höchstem klanglichen Niveau. Das breite, zugleich tiefenwirkende und immer durchsichtige Klangspektrum der Dresdner ist wie geschaffen für diese einzigartige Musik. Zusammen mit dem Chor und den Solisten sind alle durchweg gleichberechtigt zu hören. Der vom neuen Dresdner Chordirektor Jan Hoffmann einstudierte Sächsische Staatsopernchor strahlt mit enormer Kraft und beweist seine Qualitäten auch im äußersten Pianissimo und den a cappella-Passagen. Ein leicht verwackelter Beginn des beschwingten Sanctus, dem Scherzo quasi in Verdis Komposition, sei verziehen.
Gekrönt wird diese Aufführung von einem erlesenen Solistenquartett. Nicht rechts und links vom Dirigenten platziert, sondern ihm direkt gegenüber bzw. vor ihm singen die Vier und hängen Gatti förmlich an den Lippen. Es sind selbstredend sehr individuelle Sängerpersönlichkeiten, die in den Ensembles aber auch zu höchstmöglicher Verschmelzung in der Lage sind. Die ungarische Mezzosopranistin Sziia Vörös setzt im Liber scriptus proferetur einen unbestrittenen Höhepunkt. Wunderbar in allen Lagen klingt diese substanzreiche, ausdrucksintensive Stimme. Mit viel, vielleicht einer Spur zu viel Italianitá glänzt der aus Genua stammende Tenor Francesco Meli. Seine gleißenden Spitzentöne erreichen jeden Winkel im Zuschauerraum. Verdis Messa ist nun einmal eine geistliche Oper. Die Besetzung der Basspartie mit Michele Pertusi überrascht zunächst ein wenig. Passt diese warme, weiche überhaupt nicht polternde Stimme zum Tag des Zorns? Ja doch, geradezu väterlich aussöhnende Momente bringt und lockt er aus Verdis Musik hervor, zum Beispiel, wenn er von der Verheißung Abrahams singt, dass die Seelen der Toten zum ewigen Leben übergehen werden (Quam olim Abrahae). Zu vollkommener Homogenität finden die drei genannten Sänger im Lux aeterna (Das ewige Licht leuchte ihnen), getragen von der weltweit einzigartigen Tremolokunst der Kapelle (Schon Richard schwärmte vom Schimmern der Dresdner Geigen). Bleibt noch die Sopranistin Eleonora Buratti. Ihre ohnehin kräftezehrende Partie verlangt mit dem Libera me (Errette mich, Herr, vom ewigen Tode) am Ende noch einmal ein Aufbäumen aller stimmlichen und gestalterischen Leidenschaften. Buratti erschütterte damit in Dresden bis ins Mark, lotete alle Höhen und Tiefen ihres glanzvollen Soprans aus, bis dann Verdis Musik trauernd erstirbt und verklingt. Daniele Gatti wartet lange mit dem Sinken der Arme. Das Publikum erhebt sich. Minutenlanges Schweigen zum Gedenken an die Bomben- und Kriegsopfer – in unseren Tagen weit über Dresden hinaus.