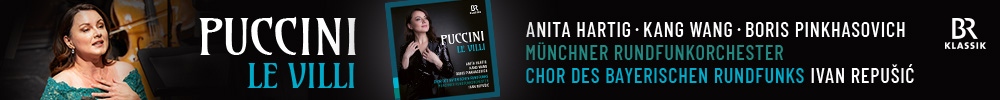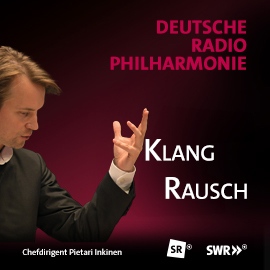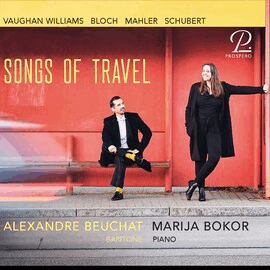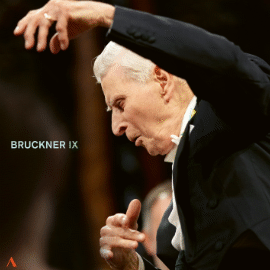Die Werke auf Ihrer CD waren eigentlich für die Traversflöte geschrieben. Sie treten den beeindruckenden Beweis an, dass die Blockflöte der Travers- bzw. Querflöte in nichts nachsteht. Was hat Sie dazu veranlasst, die Konzerte auf der Blockflöte zu spielen?
Auf meiner Suche nach einer neuen Herausforderung war relativ schnell klar, dass ich mich mit dem neuen Album an Flötenkonzerte aus der Frühklassik wagen möchte. Im Vordergrund stand dabei die Überzeugung, dass die ursprünglich für die Traversflöte konzipierten Werke auf der Blockflöte besser klingen, da wir heute in der Lage sind Blockflöten zu bauen, die ihren ursprünglichen kernigen und warmen Klang beibehalten, jedoch an voluminöser Strahlkraft dazu gewonnen haben. 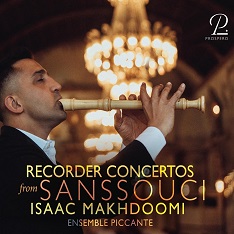 Nachdem die Blockflöte um das Jahr 1750 herum von der Querflöte verdrängt und in Vergessenheit geraten war, erfuhr sie erst in den 1920er Jahren durch den Franzosen Eugène Arnold Dolmetsch und den Deutschen Peter Harlan eine Renaissance. Auf den Grundstein dieser Wiederentdeckung folgten weitere Blockflötenbauer, die stets nach Perfektion strebten und den Blockflötenbau dahingehend entwickelten, dass wir heute in der Lage sind, auf Instrumenten zu spielen, die jene aus dem Barock im Klang, an Brillanz und an Lautstärke vermutlich übertreffen.
Nachdem die Blockflöte um das Jahr 1750 herum von der Querflöte verdrängt und in Vergessenheit geraten war, erfuhr sie erst in den 1920er Jahren durch den Franzosen Eugène Arnold Dolmetsch und den Deutschen Peter Harlan eine Renaissance. Auf den Grundstein dieser Wiederentdeckung folgten weitere Blockflötenbauer, die stets nach Perfektion strebten und den Blockflötenbau dahingehend entwickelten, dass wir heute in der Lage sind, auf Instrumenten zu spielen, die jene aus dem Barock im Klang, an Brillanz und an Lautstärke vermutlich übertreffen.
Nebst dem klanglichen Aspekt beweist für mich auch die artikulatorisch hoch differenzierte Spielbarkeit der Blockflöte, dass diese Flötenkonzerte, gespielt auf der Blockflöte, ein wunderbares Klangerlebnis abbilden, welches die Zuhörenden gleichwohl beglücken wie auch verblüffen mag.
König Friedrich II. von Preußen ist vor allem wegen seiner Kriege in die Geschichte eingegangen. Doch war er auch ein hochgebildeter Schöngeist und Musikliebhaber, der die Komponisten Johann Joachim Quantz, Carl Philip Emanuel Bach, Franz Benda und die Gebrüder Carl Heinrich und Johann Gottlieb Graun zu sich an den Hof holte. In seiner Sommerresidenz Sanssouci fanden allabendlich nicht öffentliche Kammerkonzerte statt, und es etablierte sich einer neuer Musikstil in Norddeutschland. Wodurch zeichnet er sich aus?
Mit der Thronbesteigung von Friedrich II. im Jahre 1740 etablierte sich der empfindsame Stil in der Musik. Er hatte zum Ziel, die Zuhörenden unmittelbar zu berühren. Eine Abkehr von strenger Satztechnik und überladener Klangsprache hin zu einfacher Melodik, gestützt von schlichter Harmonik, ging vonstatten, die eine subjektive und natürlichere Tonsprache anstrebte. Die individuelle Gefühlswelt steht im Mittelpunkt. So sagte Carl Philipp Emanuel Bach dann auch: « Aus der Seele muss man spielen und nicht wie ein abgerichteter Vogel. Ein Clavierist von dieser Art verdienet mehr Dank als ein andrer Musikus ».
Der König war ein passionierter Flötist, der selbst 121 Werke komponierte. Seine Vorliebe für die Traversflöte begann, als er 16-jährig den Dresdner Hofflötisten Johann Joachim Quantz kennenlernte, bei dem er umgehend Unterricht nahm und ihn für ein astronomisch hohes Gehalt später an seinen Hof verpflichtete. Welche Aufgaben hatte Quantz?
Quantz war Friedrichs wichtigster Berater und Lehrer in musikalischen Belangen und komponierte etliche Werke eigens für seinen Dienstherrn. Bis zu seinem Tod 1773 blieb Quantz im Dienst seines preußischen Schutzherrn, den er täglich zu unterrichten hatte, mit hochwertigen, selbstgebauten Traversflöten versorgte und für den er die allabendlich stattfindenden Abendmusiken vorzubereiten und zu leiten hatte.
Carl Philipp Emanuel Bach galt zu seiner Zeit als einer der berühmtesten Clavieristen Europas. Er hatte eine Festanstellung als erster Cembalist in Friedrichs Hofkapelle und schrieb zahlreiche Konzerte und Sonaten für das Cembalo. Bei dem von Ihnen eingespielten Konzert in d-Moll sind sich die Wissenschaftler uneinig, ob es ursprünglich für Cembalo oder doch für die Traversflöte komponiert wurde. Was halten Sie für wahrscheinlicher?
Barthold Kuijken zeigt in seiner Betrachtung des Werkes auf, dass das Konzert im Original einer Traversflöte zugedacht gewesen sein muss, da in den Flötensoli des Konzerts keine Stellen vorkommen, an denen Oktavversetzungen oder andere Eingriffe nötig wären, um sie für dieses Instrument spielbar zu machen. Umgekehrt gibt es in der Cembalofassung des Konzerts Umspielungen längerer Töne (die auf dem Cembalo bald verklingen) und typische Cembaloverzierungen, die nur selten für Melodieinstrumente notiert wurden.
Franz Bendas Konzert in d-Moll wurde für die Geige komponiert. Sie interpretieren es auf einer Sopran-Blockflöte. Inwieweit unterscheidet sich für Sie das Spiel auf einer Sopranflöte von dem auf einer Altflöte?
Die ursprüngliche Fassung wurde tatsächlich für Geige komponiert und von Benda für die Traversflöte nach e-Moll transponiert. In diesem Fall eignet sich d-Moll auf der Sopranblockflöte, da der Ambitus dadurch ohne große Bearbeitungen gut spielbar wird.
Auf einer Altblockflöte wäre die entferntere Tonart g-Moll die Folge, was wiederum für das Orchester schlecht umsetzbar ist. Das Spiel auf der Sopranblockflöte ist für Bendas Concerto besonders reizvoll, da die natürliche Spitzigkeit dieser Flöte ein äußerst virtuos klingendes Klangbild ermöglicht. Zudem sind Sturm und Drang in den schnellen Ecksätzen deutlich hörbar und würden auf einer Altblockflöte, im Vergleich zum Spiel auf einer Sopranblockflöte, etwas matter und nicht ebenso virtuos überzeugen können.
Ein weiteres ungewöhnliches Hörerlebnis auf Ihrer CD ist die Interpretation von Carl Heinrich Grauns Arie D’ogni aura al mormorar. Sie entstammt der Oper L‘Orfeo, die Friedrich der Große 1752 anlässlich des Geburtstags seiner Mutter Königin Sophia Dorothea in Auftrag gegeben hatte. Was hat Sie zu dieser Einspielung inspiriert und warum wählten Sie dafür eine G‘-Flöte?
Da kein anderes Blasinstrument dem Gesang so nahekommt wie die Blockflöte, lege ich großen Wert auf sangliches Spiel. So wollte ich, wie bei meinem Vivaldi-Album, auch dieses Mal eine Arie mit dabeihaben und bin dabei auf Grauns besagte Arie gestoßen, die mich sehr berührt hat. Der Reiz liegt im Verzieren des Da-Capo-Teils und im Timbre der Altblockflöte in G, welche einen speziellen Klangschmelz aufweist und der menschlichen Stimme noch näher kommt.
Auf Ihrer CD interpretieren Sie zwei Konzerte für Altflöte, spielen aber laut Ihrem Booklet drei verschiedene Altflöten. Wie setzen Sie die drei Flöten in den zwei Konzerten ein?
Für die Umsetzung auf der Altblockflöte ist bei Quantz aufgrund des Ambitus eine Transposition vonnöten. Für die Ecksätze habe ich mich für das Spiel auf einer Altblockflöte in 415Hz entschieden, wodurch ich in B-Dur greife, klanglich jedoch in A-Dur spiele. Diese Tonart ist auch für das Orchester eine sehr gelungene Variante. Den Mittelsatz wiederum spiele ich auf einer Altblockflöte in Es, welche mir das Spiel in der tiefen Lage ermöglicht. Bachs Concerto spiele ich in der Originaltonart in d-Moll auf einer Altblockflöte in 442Hz.