Krzysztof Penderecki ist tot. Seine Musik lebt weiter, wie auch die Erinnerungen an ihn. Wichtige Aussagen des Komponisten gibt es in einem Pizzicato-Interview, das unserer (ebenfalls verstorbener) Mitarbeiter Guy Wagner 2001 in Krakau mit dem Komponisten führte.
Herr Penderecki, Sie schreiben in Ihrem Buch ‘Labyrinth der Zeit’: ‘Ich bin ein Hybride’. Wie sehen Sie diesen Begriff?Ich sehe ihn vor allem in Bezug auf meine Abstammung. Meine Familie ist sehr gemischt. Meine Großmutter väterlicherseits ist eine Armenierin, stammt eigentlich aus Persien, hat also eine ganz andere Kultur mitgebracht. Mein Vater ist in der Ukraine geboren, in der polnischen Ukraine, in einem Dorf, wo eigentlich nur Ukrainer lebten, kaum Polen. Er ist getauft worden in einer russisch-orthodoxen Kirche, er hatte eine Vorliebe für orthodoxe Musik, die er mir beigebracht hat. Wir sind nach dem Krieg überall hin gereist, um diese Musik zu hören.
Die Eltern meines anderen Großvaters stammten aus Breslau, waren typische Deutsche, und während die andern mir Phantasie vermittelt haben, hat dieser mir Ordnung beigebracht. Er hat mein Leben immer organisiert. In der kleinen Stadt Debica, in der ich lebte, war er Direktor einer Bank, und er hat mir jeden Tag einen Plan an die Wand gezeichnet, was ich zu tun hatte: Wann ich für die Schule zu lernen hatte, wann ich üben musste, wann ich spielen durfte, wann gegessen wurde. Das musste alles pünktlich sein, und so bin ich aufgewachsen. Dazu war die Familie aber auch sehr tolerant, eben weil alle verschieden waren.
Wie kam es zu Ihrer Musikerziehung? Haben Sie immer Musik machen wollen? Ich habe gehört von Ihrer ersten Violine, die der Vater gekauft hat gegen…
… eine Flasche Wodka, ja!
Und das Klavier gegen zwei Flaschen Wodka…
Ja, ja! Ich habe zuerst einmal Klavierstunden gehabt, aber ich wollte eigentlich nicht. Mein Großvater hat sich dann doch wieder einmal durchgesetzt, und ich musste es tun. Ich glaube, ich hasste meine Klavierlehrerin; sie hat mich geschlagen, damals war das natürlich noch möglich.Dann hat mein Vater die Geige gekauft, er selbst hatte früher eine besessen, und er hat auch immer musiziert. Er war Rechtsanwalt, aber jede freie Stunde hat er Musik gemacht mit seinen Kollegen Rechtsanwälten: die waren alle an Musik interessiert.
Klassische Musik?
Ja, zu Hause hat man Trios und Quartette gespielt, vielleicht nicht sehr gut, denn so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, ich war noch zu jung. Dennoch! Ich hatte daheim immer Musik, auch wenn es damals keine Radios gab: Während der deutschen Besatzung waren sie verboten; auf dem Besitz eines Rundfunkgerätes stand die Todesstrafe. Trotzdem hatte mein Großvater eines, ein sehr primitives, und hat darauf BBC gehört.
Während meiner ersten Jahre, als ich Violinunterricht genommen habe, habe ich auch kaum Konzerte gehört. Dann aber hat mein Lehrer ein kleines Orchester gegründet, in dem ich Geige gespielt habe; doch dann fehlte z.B. die Trompete, und ich habe schnell Trompete gelernt und nach einer Woche konnte ich schon Trompete spielen.
Am Gymnasium habe ich danach selbst ein Ensemble gegründet. Wir wollten natürlich auf diese Weise auch unser Taschengeld aufbessern, und so haben wir bei verschiedenen Gelegenheiten Tanzmusik und Kletzmermusik gespielt. Ich habe dazu die Arrangements geschrieben, genau für die Instrumente, die wir hatten. So sah meine musikalische Ausbildung aus.
Und das theoretische Musikstudium?
Das kam erst viel später. Ich war in meiner kleinen Stadt bis zum 17. Lebensjahr, danach ging ich nach Krakau zum Studieren. Natürlich habe ich Musikbücher gelesen und allein etwas Theorie gelernt, aber das war nicht viel. Man sollte auch nicht vergessen, dass nach dem Krieg keine Noten zu haben waren. Mein Lehrer hat für mich Etüden komponiert, damit ich etwas zum Üben hatte. Das aber hat mir nicht gereicht, und schon nach 2-3 Monaten habe ich dies selbst gemacht. Das war ein Anfang. Ich habe aus Not komponiert, um etwas zum Üben zu haben. Leider ist alles davon verschollen, es war vielleicht auch nichts wert, dennoch: das waren meine ersten Versuche.
Wie war denn ganz allgemein das Leben eines Jungen, der mit sechs Jahren den Krieg und die Besatzung erfährt?
Es war einfach schrecklich. Der Tod kreiste um uns. Die Hälfte meiner Familie ist getötet worden von den Deutschen und den Russen. Als die Deutschen kamen, hatte mein Großvater, der ein Deutscher war, alle Papiere verbrannt, und seine Söhne waren alle in Widerstandsorganisationen, auch mit Pilsudski gegen Russland. Einen Onkel, der mir sehr nahe stand, hat man in Warschau erschossen, ein anderer wurde 1939 in Lembach sofort von den Russen verhaftet und danach in Katyn umgebracht.
Kaum waren die Nazis weg, hat man Polen seine Freiheit bereits wieder genommen…
Im Grunde war das noch schlimmer. Diese furchtbare Propaganda! Ich kann mich sehr gut erinnern: Zwar konnte man noch kein Radio kaufen 1945, 46, 47, aber überall in den Straßen waren große Lautsprecher, und dann war von 5 Uhr früh bis 11-12 Uhr nachts Propaganda, Militärmusik, Volksmusik… So bin ich aufgewachsen. Die wahre Geschichte lernte man auch nicht in der Schule, sondern daheim.
Bei einer Vorstellung Ihrer Werke in der Alten Oper Frankfurt sprachen Sie davon, dass Sie sich lange Zeit gegen die russische Musik gewehrt haben, schon allein, weil Polen von den Russen besetzt war.
Wir waren so sehr gegen die Russen, dass wir auch gegen die russische Literatur waren, leider. Da die offizielle Musik die war, die von Russland kam, – also gerade auch Shostakovich, den ich heute sehr verehre –, haben wir auch sie abgelehnt. Ich kann mich noch erinnern, dass, wenn Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre, Shostakovich nach Warschau zum Festival kam, er so gut wie isoliert war. Niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Das war zwar ganz dumm, aber das war ein Ausdruck der politischen Rebellion gegen die russischen Besatzer.
In dem gleichen Gespräch sagen Sie, dass Sie sich immer zur deutschen Musik hingezogen fühlten.
Das kam natürlich später. Als ich ganz jung war, war ich fasziniert von der Musik des 19. Jahrhunderts, der virtuosen Musik. Das ist zwar schwer zu glauben, aber irgendwie ist es in mir geblieben, vielleicht dadurch, dass ich dann doch kein Geiger geworden bin, sondern Komponist. Das Virtuose bleibt dennoch spürbar in meiner Musik, und ich bin einer von den wenigen Musikschöpfern von heute, der so viele instrumentale Konzerte geschrieben hat. Für Geige, Cello, Flöte, Oboe… und nun auch ein Tripelkonzert. Demnach ist dies ein wichtiger Aspekt meiner Musik.
In den 50er und 60er Jahren wurde allerdings ist nicht für, sondern gegen das Instrument geschrieben. Auch meine ersten Konzerte sind natürlich sehr kompliziert, mit vielen neuen Techniken, aber sie sind alle für das Instrument komponiert.
Warum wurde Ihnen diese Schaffenskomponente so wichtig?
Ich kam zur Musik durch meine Geige, also nicht durch Theorie, sondern durchs Praktikum, und ich habe immer schwieriger komponiert als ich selbst spielen konnte. Ich wollte immer über das hinausgehen, was ich an Möglichkeiten hatte.
Sie wollten sich selbst überbieten …
Ja, und ich glaube, das mache ich bis jetzt.
Eine Frage zu Ihren ersten Kompositionen: Das war doch ein Bruch mit vielem, was vorher komponiert worden war. Für mich beispielsweise waren die Überlegungen bedeutsam, die Sie in ‘De natura sonoris’ angestellt haben. Hier findet man gleichzeitig Forschung und Ergebnis.
Stimmt! Ich wollte eigentlich alle Möglichkeiten für das Orchester ausprobieren. Das Werk ist dadurch natürlich kein ‘Katalog’, sondern Musik. In erster Linie hat mich die Erweiterung der Möglichkeiten fasziniert, vor allem, was die Instrumente angeht, die ich am besten kannte: die Streicher. Ich habe dabei nicht nur mit der Geige, sondern auch mit dem Kontrabass und dem Cello experimentiert. Dies tat ich sogar in der Zeit, als ich im elektronischen Studio in Warschau gearbeitet habe und die Instrumente verfremdete.
Dann aber ging meine Überlegung in eine andere Richtung: Ich wollte nicht mehr verfremden, das war mir zu einfach, sondern wie etwa in Threnos, die Harmonie zerstören, die Harmonien, die ich jahrelang gelernt hatte. Ich wollte alle Regeln vergessen und ganz neu schreiben. Zwischen Klang und Geräusch. Das verdanke ich auch dem elektronischen Studio, trotzdem es ganz primitiv war. Wir hatten keine Synthesizer, alles Manufaktur, aber ich habe Hunderte von Stunden dort gearbeitet, und es hat meine Phantasie angeregt, weil es anders war.
Werden Sie durch neue Klänge angeregt, geben diese Ihnen Impulse?
Ja. In der Zeit Ende 50, Anfang 60, war der Klang für mich sehr wichtig, doch vor allem hat mich interessiert, die Form zu suchen und mit verschiedenen Möglichkeiten zu füllen. Mein jetziges Komponieren, das nun ziemlich anders ist als früher, hat dennoch mit meinem damaligen Schaffen gemeinsam, dass ich zuerst auf Form aufbaue. Wenn ich ein geistliches Werk nehme, ist klar, dass zuerst einmal der Text sehr wichtig ist. Ich arbeite mit dem Text wie mit einer Art von Libretto, und vom Text ausgehend, entsteht Form.
Auffallend ist, dass Sie nie gezögert haben, Fragen zu stellen und Themen anzugehen, die die Menschen bewegen: Auschwitz, Hiroschima, und auch dies bereits in der ersten Phase Ihres Schaffens.
Wissen Sie: Würde ich in Australien oder Neuseeland leben, schriebe ich bestimmt ganz andere Musik, aber ich lebe in einem Land, das grausame Zeiten durchlebt hat. Das ist ein wichtiger Punkt, darum schreibe ich z. B. geistliche Musik. Als ich in den 50er Jahren angefangen habe, war es einem jungen Komponisten zwar erlaubt, solche Musik zu schreiben, aber sie wurde nie aufgeführt. Gerade das aber hat mich herausgefordert. Zwölftonmusik war ebenfalls so gut wie verboten; meine Lehrer hatten keine Ahnung davon.
Nach ein paar Jahren Studium aber hatte ich das alles gelernt und die Lücke, die für mich da gewesen ist, aufgefüllt: Wir wussten, trotz aller Hindernisse und Behinderungen, was im Westen vor sich ging und wie die Entwicklung war. Manchmal kamen auch Partituren ins Land, aber ich konnte überhaupt nicht reisen. Erst im Dezember 1959 bekam ich einen Pass und hätte meinen Traum erfüllen können, nach Darmstadt zu gehen: Das war Mekka, mein Ziel als Student! Ich habe regelmäßig Briefe geschrieben, habe auch jedes Jahr von Darmstadt ein Stipendium bekommen, aber „die“ haben mir einfach Pass und Ausreise verweigert… Dennoch habe ich angefangen eine neue Musik zu schreiben.
Nach 1956 wurde es für uns in Polen ein bisschen leichter; 1957 kam Luigi Nono hierher; der Warschauer Herbst hatte schon begonnen, und behutsam hat man die Klassik der Moderne zugelassen: Schönberg, Webern – das waren für uns Offenbahrungen – Honegger, Orff… Strawinsky, aber, als russischer ‘Verräter’, der in den USA lebte, durfte nicht aufgeführt werden.
1959 hatte man einen Wettbewerb für junge Komponisten ausgeschrieben, dessen erster Preis eine Reise in den Westen war, und ich sagte mir: Ich muss den bekommen, denn wenn ich ihn nicht erhalte, werde ich nie reisen dürfen! So habe ich drei Kompositionen eingereicht und alle drei Preise erhalten.
Das ist bereits jetzt Musiklegende geworden…
Ich habe es ganz bewusst gemacht. So bewusst, dass ich mir überlegt hatte, dass die Werke verschieden sein müssten, damit niemand auf die Idee käme, dass ich sie komponiert hatte: Psalm, noch in der Richtung Strawinsky und vielleicht ein bisschen Orff auch, Emanationen für zwei Orchester, die um einen halben Ton umgestimmt sind, ein für die damalige Zeit sehr modernes Werk, und Strophen…
Als ich nun aber die Möglichkeit bekommen hatte, wollte ich plötzlich nicht mehr nach Darmstadt. Ich dachte: Was soll ich dort? Ich kenne schon diese Musik, habe sie gehört und sie hat mich nicht dermaßen beeindruckt: Das war schon zu spät für mich, weil ich bereits angefangen hatte, Threnos zu schreiben, die Skizzen zu Kanon für Streicher, und vor allem: Ich bekam 1959, vor meiner Reise, einen Auftrag von Donaueschingen, und ich habe Anaklasis komponiert, und das war doch anders als Darmstadt! Ich glaube, ich habe damit etwas Neues gefunden. Vielleicht durch die Isolation, in der ich so lange leben musste, sodass es vielleicht gut war, dass die mir keinen Pass gegeben hatten, denn so musste ich in mir suchen, statt eine Kopie von Westlichem zu machen.
Wie stark ist Literatur für Sie als Inspirationsquelle?
Sehr stark. Fast die Hälfte meines Oeuvres ist von Literatur beeinflusst. Für meine geistliche Musik ist die Bibel das Hauptbuch: immer findet man dort Texte, die faszinierend sind.
Sie setzen sich auch mit Kunst auseinander, und immer wieder taucht der Name Kandinsky bei Ihnen auf.
Das ist wahr! Kandinsky war auch einer der wenigen, die sehr gut schreiben konnten, nicht nur malen. Was ebenfalls sehr wichtig ist: 1951 kam ich nach Krakau zum Universitätsstudium, und da war das Tadeusz Kantor-Theater…
Kantor ist, so weit ich weiß, ein Cousin von Ihnen.
Ja, ein genialer, aber ganz verrückter Kerl. Durch ihn begann mein Interesse fürs Theater. Ich war immer in seinen Proben, und die waren sehr inspirierend. Ich habe allerdings nie Musik für ihn geschrieben, da wir uns nicht einigen konnten. Ich bin stur, er war es noch mehr, und für meine damaligen Begriffe – jetzt sehe ich das anders –, hatte er ein ganz banales Interesse für Musik. Er hat immer so einen Schlager genommen und wiederholt und wiederholt. Das hatte natürliche eine tolle Wirkung im Theater gehabt, aber diese Musik, ein Soldatenlied etwa aus dem 1. Weltkrieg, war nun nicht das, was mich interessierte. Doch sein Theater als solches hat mich sehr inspiriert.
Kantor ist ja auch weltweit bekannt geworden, weil er Emotionen auf die Bühne gebracht hat. Er selbst spricht vom Theater der Emotionen.
Man weiß nicht genau, wie das funktioniert, was beeinflusst. Bei mir ist es jedenfalls auch das Visuelle. Ich habe als Kind bei meinem Großvater gemalt, der ein Sonntagsmaler war. Jeden Sonntag bei gutem Wetter ging ich mit ihm nach draußen, und so ist das Visuelle bei mir sehr stark ausgeprägt. Ich male, ich zeichne die Form. Für jemanden, der das nicht versteht, ist dieses Element in meinen Partituren nur Grafik, für mich nicht: Das ist Form, die man sehen kann, und für mich immer der Beginn jeden Stückes, das ich schreibe.
Innerhalb des strengen Rahmens der Form geben Sie aber der Imagination die Gelegenheit, sich zu entfalten, obschon Sie von der ‘Krise der Imagination’ sprechen. Liegt sie darin, dass uns die Bilder durch Film und Fernsehen ‘aufgesetzt’ werden, so dass wir selbst nicht mehr fähig sind, solche zu entwickeln? Dass wir dermaßen erdrückt werden von Einflüssen von außen, dass die Imagination kaum noch Möglichkeiten hat, sich von innen zu entfalten?
Es ist schwer über Phantasie und Imagination zu sprechen, man kann sie verbal nicht fassen. Am Ursprung bei mir ist immer ‘claritas’, die Form, sehr oft sehr abstrakt, und dann suche ich Motive und Themen, die dazu passen. Ich suche, ich bohre. Von einem kleinen Motiv ausgehend, suche ich immer weiter; es wird immer komplizierter. Die Emotionen kommen später, in der Ausarbeitung meiner Ideen.
Ihr Werk spielt auch auf dem Widerspruch zwischen Sacrum und Profanum.
Ich würde sagen: Meine Musik, das sind die beiden Strömungen. Sacrum, klar, das sind Werke wie Passio und das rezentere Credo, aber das Profanum, z. B. die Form der Symphonie, interessiert mich in den letzten Jahren immer stärker.
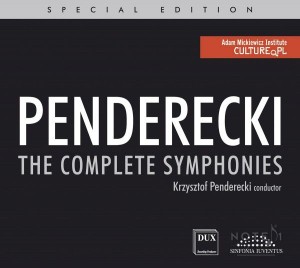 Zur Symphonik sind Sie aber erst nach Ihrem 40. Geburtstag gekommen. Wieso?
Zur Symphonik sind Sie aber erst nach Ihrem 40. Geburtstag gekommen. Wieso?
Ganz bewusst. Ich wollte vor meinem 40. Lebensjahr keine Symphonie schreiben. Ich glaube, man kann auch nicht, man darf auch nicht. Viele Komponisten sind erst spät zur Symphonie gekommen: Dvorák, Brahms…, und das ist auch richtig. Eigentlich habe ich meine erste Symphonie zu meinem Geburtstag komponiert, das war im November 1973.
Und die 6., ‘Elegie für einen sterbenden Wald’?
Das ist meine Pastorale! (lacht).
Sie setzen sich ebenfalls mit dem Thema weltlicher Macht auseinander, dem Kampf um Macht. Ich denke an ‘Ubu Rex’, ‘Schwarze Maske’…
… und vor allem ‘Die Teufel von Loudun’, meine erste Oper!
Wie stehen Sie denn zu diesen stets wieder erneuten Popanzen, die an die Macht drängen, andere davon verdrängen und uns weiterhin blenden, trotz allem, was man weiß oder wissen müsste?
Das liegt auch an der Zeit, in der man lebt, und dem Platz, wo man wohnt. Sehen Sie doch nur Polen, das Streben nach Freiheit, die Unmöglichkeit, aus dem Tunnel herauszukommen, ohne Licht am Ende: Wir haben nach all den Jahren fast keine Hoffnung mehr gehabt, und das hat sehr auf mich gewirkt.
Sodann die großen Themen: Sündenfall, Passion oder Apokalypse, die mich immer wieder inspiriert haben. Ich wollte meine Zeit nicht damit verlieren, Kleinigkeiten zu machen. Und Ubu, diese bittere, skurrile, politische Geschichte, die immer noch passt. Das Werk war aktuell Ende des 19. Jahrhunderts, aber noch aktueller war es zu der Zeit, als ich die Oper schrieb, und jetzt ist es wieder aktuell.
Ist der Sarkasmus, den man in Ihrer Musik findet, Ausdruck der Verzweiflung oder der Möglichkeit einer Abwehr, einer Gegenwehr, sozusagen, um sich ein Immunsystem zu bilden?
Das zweite, ja! Aber da will ich gerne gestehen: Da bin ich beeinflusst von Shostakovich und seinem Sarkasmus. Der durfte schon gar nicht direkt sagen, was er wollte, doch wenn man seine Werke hört, die Opern oder Ballette, aber auch seine Symphonien und seine Kammermusik: der Sarkasmus kommt aus jeder Ecke, meistens in den Scherzi, diesen apokalyptischen Scherzi schon an der Grenze von Trivialität, ohne dass man aber auf die andere Seite träte. Nur ein großer Komponist kann sich das leisten. Und das liebe ich. Wenn ich ein Zitat nehme, das jeder kennt, aus einem Volkslied oder einem Kirchenlied, kann man wohl sagen, das sei banal, aber wenn es kunstvoll gemacht ist und an der richtigen Stelle erscheint, bekommt es eine konkrete Wirkung.
Sie sprechen vom ‘Labyrinth der Zeit’. Denken Sie an ein Ende, wenn Sie von Zeit sprechen?
Ein Labyrinth ist: immer auf der Suche zu sein. Man verliert sich sehr oft auf den verschiedenen Wegen, und dann muss man zurückgehen. Das ist genau, was ich mache: Ich gehe ein paar Schritte vorwärts, aber dann erschrecke ich, und ich muss zurück. Ich öffne die Türe hinter mir, um zu sehen, was es dort gibt, dann gehe ich weiter, schon auf einem anderen Weg. Für mich bedeutet Labyrinth auch: sich zu verstecken,
Eines Ihrer Werke heißt: ‘Dimensionen der Zeit und der Stille’. Demnach, wiederum die Frage der ‘Zeit’…
Das ist für mich Kontinuum. Ende 50-Anfang 60, als ich dachte: Ich muss alles vergessen, was ich gelernt habe, ich muss etwas völlig Neues suchen, vielleicht wird die Zukunft der Musik nur Elektronik sein und wir werden das Orchester vergessen, war bereits das Gefühl da, dass die Musik ein Kontinuum ist und dass man nicht weiterkommt, ohne zurückzublicken.
1962, mit Fluorescences, war eigentlich schon alles zerstört: Spielweise, Form, das Orchester als solches, sie alle schienen schon zu vergessen zu sein. Doch nur zwei Monate später habe ich Stabat Mater komponiert, wo ich zurückgehe auf die Renaissance-Polyphonie, die alten Niederländer, und man spürt doch, glaube ich, diese Technik, und gerade das ist irgendwie immer in mir geblieben: Etwas Neues suchen, aber als Basis verwurzelt sein in einer Vergangenheit und einer Geschichte.
Anderes Beispiel: die Lukas-Passion. Sie war wirklich ganz neu, aber ohne die Passionen von Bach hätte ich sie nie schreiben können.
Drittes Beispiel: das Zurückkommen auf die Form der Symphonie. Vielleicht bin ich zu fest verwurzelt, als dass ich mich da trennen könnte.
Und was bedeutet Stille in einer Welt des Lärmes?
Stille ist mein Labyrinth, wo ich mich verstecken kann. Manchmal schreibe ich gerade Werke, als ob die Geschichte stehen geblieben wäre. Eigentlich möchte ich gar nicht zuviel zu tun haben mit dem, was um mich herum geschieht. Wenn ich dann in mein Labyrinth hineinkrieche, glaube ich, dass ich, abgesehen davon, was man da schreibt oder spricht, doch in mir etwas suchen und meine eigene Musik und Gefühle entwickeln kann.
Auch in Ihr Arboretum ist ein Labyrinth eingezeichnet.
Es sind deren zwei. Eines habe ich vor fast 25 Jahren angelegt, und gerade pflanze ich ein ganz großes, auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern. Da kann man sich wirklich drin verlieren. Da werde ich vielleicht meine Feinde hineinführen und dann dort lassen. (Lachen)
Ich komme auf die Frage der Kammermusik zu sprechen, die für Sie, im Gegensatz zur allgemeinen Strömung im 20. Jahrhundert, eine bedeutende Rolle spielt.
Ich schreibe deren immer wieder, als ‘offspring’, wenn ich ein größeres Werk komponiere. Da mache ich Notizen, und die Themen die ich nicht in diesem Werk benutze, verwende ich in meiner Kammermusik. Aber auch Themen, die ich schon gebraucht habe, verwerte ich darin auf eine ganz andere Art. Kammermusik ist für mich Intimität, ‘musica domestica’. Das ist ausschließlich meine Musik. Natürlich soll sie aufgeführt werden, doch es ist für mich die Musik, wo ich mich am sichersten fühle. Es ist allerdings viel schwieriger, ein Trio zu schreiben als eine große Symphonie oder ein Oratorium.
Worin liegt diese besondere Schwierigkeit?
Weil das alles nackt ist, alles bloß und offen liegt. Da kann man keine Lücke ausfüllen oder überdecken mit Orchesterfarben, sondern es muss pure Musik sein, und so ist das schon immer so gewesen. Nimmt man z. B. Beethovens Kammermusik oder Brahms oder Schostakowitsch, so ist das ihre intimste Musik und vielleicht die höchste.
Nun zu Ihrem Credo: Das Crucifixum in dessen Zentralteil, dem dritten, sagt viel aus über Ihre eigene Auseinandersetzung mit dem Leid der Welt. Das ist nicht mehr nur das Leid des Individuums, eines Mannes namens Jesus, sondern es geht um universelles Leid. Die Musik ist zum Ausdruck eines Leidens und Mitleidens geworden. Wie stehen Sie zur Frage des Bösen in der Welt?
Ich weiß nicht, was ich da antworten soll, es gibt keine Antwort darauf. Nur in der Musik, kann ich eine solche gebe, in Werken wie dem Polnischen Requiem oder eben Crucifixus, dem Intimsten im Credo, schon fast kammermusikalisch, drei Celli und eine Stimme… (Schweigen). Wenn ich daher einen Text wie das Credo mit 67 Jahren vertone, heißt das doch, dass ich auf irgendeine Weise an irgendeine Auferstehung glaube. Das gibt mir Kraft. Sonst würden Tenebrae herrschen.
Stichwort Tenebrae: Sie leben in Krakau. Krakau liegt 75 Kilometer von Auschwitz entfernt. Ich bin durch Auschwitz gegangen und trage dieses Entsetzen mit mir weiter. Wie kann man da noch glauben?
Nun ja, was bleibt uns übrig, wenn wir alles verloren haben und auch noch den Glauben verlieren? Dann ist alles hoffnungslos. Ich gestehe: Der Glaube hat mir in meinem Leben durch Suchen viel geholfen.
Ich kann aber auch einen anderen Standpunkt verstehen. Ich habe gerade noch heute Morgen ein interessantes Gespräch geführt mit meinem Freund Boris Carmeli. Der war drei Jahre in Auschwitz. Er kam dorthin als Vierzehnjähriger, und weil er sehr groß war, hat er im Krematorium beim Leichenverbrennen arbeiten müssen. Ich habe ihn gefragt, ob er noch in eine Synagoge gehe, und er hat mir geantwortet: Nein, nein, der Gott kann doch nicht existieren, der das zulässt, was ich gesehen habe.
Gott sei Dank, habe ich so etwas nicht erlebt, nicht direkt. Carmeli hat schon recht: Wie kann man in einer so grausamen Welt, besonders nach dem grausamsten Jahrhundert überhaupt in der Menschheitsgeschichte, noch Glauben bewahren? Ich selbst aber wusste für mich keine andere Lösung, und der Glaube gab mir auch Inspiration.
Zur Frage der Apokalypse: Denken Sie Ihr Werk für heute, oder als eine Arbeit hin zu einer Endzeit. Wie sehen Sie den schöpferischen Prozess?
Ich glaube nicht an eine End-Zeit. Es wird weitergehen, aber das Thema ist natürlich sehr reich und groß. Denken Sie nur, wie Messiaen es im Quatuor pour la fin des temps behandelt hat oder wie Schönberg es getan hat.
Sie haben lange als Pädagoge gearbeitet, und das heißt ja, an die Jugend glauben.
Genau. Ich arbeite weiterhin sehr viel mit Jugendorchestern. Das finde ich sehr wichtig. Die werden doch die Musik, die von anderen und auch meine, weiter tragen. Hoffentlich. Etwas anderes ist Kompositionsunterricht. Daran habe ich nie geglaubt. Zudem hat mir die Zeit dafür gefehlt. Um so etwas zu tun, braucht man fünf, sechs, sieben Jahre, bis ein Verständnis kommt.
Was bedeutet Dirigieren für Sie?
Wenn ich eigene Werke dirigiere, ist das die Suche nach dem, was verloren gegangen ist. Ich glaube, kein Komponist ist imstande, das zu schreiben, was er wirklich möchte. Irgendwie aber findet man, wenn man ein Stück aufführt, sehr oft unbewusst das wieder, was verloren gegangen ist, weil man nicht imstande war, es zu notieren, oder weil die Phantasie viel größer und reicher ist, als man fähig ist, aufs Papier zu setzen. Doch ich bringe es mit, wenn ich am Dirigierpult stehe, und bei einer guten Aufführung kommt es wieder, irgendwie, vielleicht nicht hundertprozentig, aber deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass der Komponist auch versucht, eigene Werke selbst zu interpretieren.
Das ist nicht nur mein Problem, es ist überhaupt ein Problem. Ich bin nämlich überzeugt, dass ein Komponist wie Beethoven mit seiner genialen Phantasie und Vision, aber mit den schlechten Orchestern und den schlechten Instrumenten von damals, nicht imstande war, überhaupt das zu schreiben, was er wollte. Oder etwa auch Chopin mit den Klavieren von damals. Erst jetzt klingt diese Musik.
Was heißt Tradition für Sie?
Für mich ist Tradition alles. Meine Musik würde nicht existieren, ohne die bewusste Fortsetzung der Tradition.
Wen sehen Sie denn als Ihre Vorfahren an? Wie sieht Ihr musikalischer Stammbaum aus?
Wie bereits gesagt: Ganz am Ursprung, stand die virtuose Musik, Paganini, Vieuxtemps… Das ist die Musik, die mich als Kind sehr beeinflusst hat, und bis heute taucht daher auch immer wieder Virtuosität bei mir auf, nicht direkt, dafür oft skurril.
Später hat eine Kollegin in der Schule mir Bachs Suiten für Geige zukommen lassen, und da habe ich etwas entdeckt, von dem ich vorher keine Ahnung hatte. Danach wurde die Vor-Bach-Zeit, vor allem die niederländische Hochrenaissance, für mich wichtig, und schließlich, alle gute Musik, die später geschrieben wurde: Beethoven, Brahms, aber auch Tschaikowsky und Shostakovich…
Mahler?
Mahler ja, aber insbesondere Bruckner. Er steht mir näher als Mahler. Stilistisch ist er von gleich bleibender Konsequenz, und seine Musik ist wie aus Stein gehauen. In Mahler findet man alles, alle Schmerzen der Welt; Demut aber findet man bei Bruckner, und die ist heute schwer zu finden.
Wie ist es zu Ihrer Liebe zu den Bäumen gekommen?
Ich weiß es nicht mehr. Mein Urgroßvater war Förster gewesen, aber ob die Gene über vier Generationen hinweg gewirkt haben sollen… Als Kind war ich allerdings schon sehr interessiert an Bäumen und Pflanzen, hatte nur keine Möglichkeit, etwas in dieser Hinsicht zu tun; immer aber wollte ich es. Ich habe dann später, um ein Haus zu bauen, außerhalb Krakau ein Stück Land gesucht, wo es bereits alte Bäume gab, und habe ein solches auch gefunden: den Rest eines Parks, der nicht mehr als solcher existierte und interessierte. Ich habe damit dreieinhalb Hektar Land gehabt; meine Pläne aber waren viel größer. Auf Papier habe ich danach die Pläne eines Arboretums gezeichnet, doch die liefen auf das Grundstück meines Nachbarn hinaus. Bis ich das Terrain habe kaufen können, dauerte es 20 Jahre. Nun aber bin ich dort angelangt, wo ich ursprünglich hin wollte.
Das war, wie eine Symphonie zu planen. Man hat eine Idee, eine Vision, und dann realisiert man sie. Danach habe ich systematisch begonnen, Bäume zu sammeln, die natürlich in unserem Klima überleben konnten, und jetzt sind es 1.500 Arten. Das ist schon fast die Grenze dessen, was man pflanzen kann, doch man findet noch immer wieder etwas Neues, und gerade das ist das Wunderbare: Einen Park zu pflanzen, der erstens nie fertig wird, ein offenes Kapitel bleibt, und zweitens, den man nicht für sich macht. So habe ich kürzlich zwei Eichenalleen angelegt, die ich nicht mehr erleben werde, denn die wachsen bekanntlich sehr langsam. Das aber spielt keine Rolle, denn diese Allee wird zu einer Verlängerung meines Lebens und seiner Interessen. So pflanze ich z. B. auch keine Pappeln, die ich bald sehen könnte.
Eine letzte Frage betrifft Frau Elzbieta Penderecka. Wir haben die Gelegenheit bekommen, ihre Kompetenz, Energie und Weitsichtigkeit erkennen und bewundern zu können.
Meine Frau ist unentbehrlich. Ohne sie hätte ich nie so weit kommen können. Sie organisiert mein Leben; manchmal will sie sogar zuviel, aber, das, was sie imstande ist, auf die Beine zu setzen, ist ganz außergewöhnlich. Ich nehme als Beispiel nur das, was sie in Krakau geleistet hat. Konzerte in der Karwoche hat es nie gegeben, die waren tabu, da gab es, wegen der strengen katholische Kirche, überhaupt keine Musik. Aber jetzt kommt sogar der Kardinal am Karfreitag ins Konzert. Sie hat die Tradition gebrochen, und sie erfüllt das, was sie tut, mit Seele. Das ist eine seltene Gabe, und ich glaube, gerade das spüren die Leute auch.





























