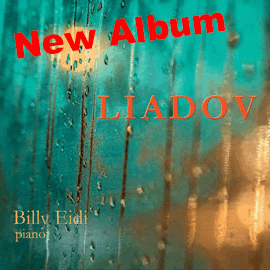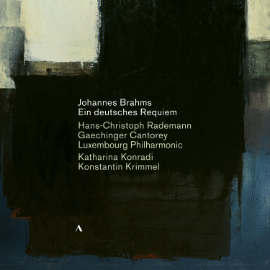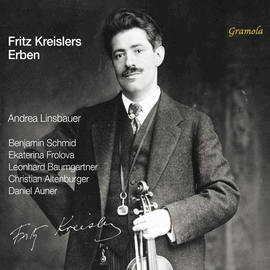Auf Ihrer großen Europatournee spielen Sie diesmal unter anderem ein Werk des amerikanischen Komponisten Henri Cowell, der hier in Europa nicht so bekannt ist. Was können Sie uns über diesen Komponisten und seine Musik sagen?
Nun, Cowell ist ein amerikanischer Komponist, der in seiner Musik gerne Grenzen überschreitet und neue Klänge ausprobiert. Seine Musik ist sehr vielseitig, oft konfrontiert sie den Zuhörer, fordert ihn regelrecht heraus. Aber sie kann auf der anderen Seite gerade so amüsant sein. Cowell kann in seinen Werken sehr poetisch, ein anderes Mal kann sie ein sehr komplexer Angriff auf die Sinne des Zuhörers sein und ihn zwingen, sich neuen Klängen zu stellen. Cowell gehörte zu einer Gruppe kalifornischer Komponisten, die sehr eng mit der ‘San Francisco Bay Area’ verbunden waren, ebenso wie seine Zeitgenossen John Cage und Lou Harrison. Sie alle hatten einen sehr unabhängigen Stil, der sich von gängigen Traditionen entfernte, der neue Wege in der Gestaltung suchten und der wirklich weltoffen waren. Charakteristika, die sich nicht nur bei dieser Gruppe von Komponisten wiederfinden, sondern auch bei ‘ihrem’ Orchester, dem San Francisco Symphony Orchestra.
Zwischen Cowells Musik und dem 2. Klavierkonzert von Bela Bartok, das Sie ebenfalls auf dieser Tournee spielen, gibt es aber direkte Parallelen.
Ja, beide Komponisten benutzen das Klavier als Perkussionsinstrument und beide waren von den Traditionen der Volksmusik fasziniert. Bartok hat sogar Cowell um Erlaubnis gefragt, ob er ähnliche Cluster, wie Cowell sie erfunden hatte, in seinem 2. Klavierkonzert benutzen dürfte. Da sieht man, wie hoch Bartok seinen amerikanischen Kollegen einschätzte.
Wenn ich mir heute Musik von zeitgenössischen amerikanischen Komponisten wie Rouse, Danielpour oder Ballada anhöre, bin ich immer wieder physischen Kraft und der dynamischen Expressivität ihrer Werke fasziniert. Es scheint, als hätten es die Amerikaner leichter, zeitgenössische Musik für den Hörer greifbar und verständnisvoll zu machen, als die beispielsweise europäische Komponisten mit ihren oft hochintellektuellen Werken tun.
Amerikanischer Musiker zu sein, bedeutet Abenteuergeist zu haben. Die ganze Entwicklung der amerikanischen Musik basiert auf dieser Vision, sich ständig neu zu erfinden und somit eine unwahrscheinliche Bandbreite an stilistischer Diversität zu zeigen. Diese Diversität rührt aber auch von den überlieferten Melodien der traditionellen amerikanischen Musik her, die oft als unkultiviert, wild, primitiv und gefährlich angesehen wurde. Doch heute stehen die amerikanischen Komponisten zu dieser Tradition, weil sie gemerkt haben, dass sie viel Wesentliches enthielt und zum Teil sogar sehr innovative Züge besaß. Aber diese Nähe zur Folklore, nennen wir sie einmal so, ist allerdings nicht ausschließlich ein amerikanischer Charakterzug. Während amerikanische Komponisten ihre nationale Musik erst im 20. Jahrhundert für sich entdeckten, hatten dies die russischen Komponisten schon im späten 19. Jahrhundert getan.
Womit wir bei Tchaikovsky wären. In Luxemburg spielt das ‘San Francisco Symphony Orchestra’ dessen 5. Symphonie. Was hat Sie bewogen, gerade dieses vielgespielte Werk auf Ihr Tourneeprogramm zu setzen?
Ich hatte als Student und junger Musiker noch das große Glück, Tchaikovskys Musik mit Interpreten wie Gregor Piatigorsky, Jascha Heifetz und Anton Rubinstein zu hören. Sie haben mir beigebracht, wie elegant diese Musik doch ist. Und heute erlebe ich es als wirkliche persönliche Herausforderung, mich der Musik von Tchaikovsky noch einmal zu stellen. Und ich habe sehr viel Neues in ihr entdeckt.
Sie selbst waren ein guter Freund von Leonard Bernstein, der wie Sie ebenfalls ein großer Verfechter der amerikanischen und russischen Musik war. Was für eine Art Musiker war er und wie hat er selbst als Komponist die amerikanische Musik beeinflusst?
Bernstein war ein Mensch und ein Musiker, der sich immer sehr viel Zeit nahm. Für seine Studenten, für seine Familie und für seine Freunde. Er ging wirklich sehr großzügig mit seiner Zeit um. Und durch diese Eigenschaft hatte er einen sehr intensiven Kontakt mit Generationen von Musikern, weil er ihnen durch seine ehrliche Aufmerksamkeit vermittelte, dass er sie schätzte. Bernstein war ein Denker und ein Abenteurer, er hatte einen enorm scharfen Verstand und eine ebenso enorme Arbeitsdisziplin. Und natürlich eine außergewöhnliche Energie. Darüber hinaus war er ein sehr lustiger Mensch, der gerne Späße machte. Durch sein offenes Wesen fiel es ihm leicht, Menschen zu begeistern und sie auf seinem Weg einfach mitzunehmen. Leonard Bernstein beherrschte viele musikalische Stile, darin war ein absoluter Meister. Und er war immer auf der Suche, wie er seine Musik noch besser machen und weiterentwickeln könnte. Sein Einfluss als Interpret und Komponist ist bis heute spürbar.
Könnten Sie uns in einigen Worten die Anfänge der amerikanischen schildern?
Für uns in Amerika geht alles zurück auf unseren ersten Komponisten, William Billings. Er war ein Komponist von Hymnen und mehrstimmigen Liedern, Stücken von einer großen Rauheit und einer irgendwie gemeißelten Grobheit. Aber der Ursprung der amerikanischen Musik findet sich in der religiösen Musik, die von England nach Amerika gebracht wurde. Das ‘Bay Psalm Book’ wurde bereits zehn Jahre nach der Ankunft der ersten Pilgerväter in Amerika, also im frühen 17. Jahrhundert veröffentlicht. Ich sage bereits, weil es bewundernswert war, dass man damals trotz aller schwieriger Umstände, die eine solche Besiedlung mit sich brachten, trotzdem noch die Zeit fand, ein solches Buch zu drucken. Aber die musikalische Qualität ließ damals in allen Bereich sehr schnell nach. Man hatte in den Kolonien andere, lebenswichtigere Probleme zu lösen, so dass es keine musikalische Erziehung gab, geschweige denn ernstzunehmende musikalische Aufführungen. Am Anfang des 18 Jahrhunderts stellte man dann fest, dass selbst die Lieder, die man zu religiösen Zwecken sang, absolut chaotisch klangen und eher an das Grunzen von Tieren als an den Gesang religiöser Menschen erinnerte.
Danach errichtete man dann Musikschulen, wo in den meisten Fällen Amateurmusiker unterrichteten. Sie waren Hutmacher, Schreiner oder Schmied, aber sie beherrschten die Kunst des Singens und Notenlesens. Hier konnte man das Singen nach Noten erlernen. Und die ersten Komponisten wie Billings oder Timothy Swan gehörten ebenfalls dieser Gruppe von Handwerkern an und auch sie unterrichteten das Singen. Sie nannten sich selbst ‘tune-smiths’, was so viel bedeutet wie Klang- oder Musikschmied und sie brachten oft Ansätze ihres Handwerks mit in ihre Kompositionen. Die Musikschulen besaßen eine wichtige soziale Rolle, weil hier Jungen und Mädchen zusammen waren und zusammen etwas erlernen konnten. Billings wurde mit seinen Hymnen und Psalmen ein sehr gefeierter Komponist. Einige seiner Lieder wurden während des Unabhängigkeitskrieges gesungen. Billings, der ein sehr religiöser Mensch war, bildet an sich die musikalische Grundbasis für viele Musiker, die nach ihm kamen.
Wie ging es dann weiter?
Zur gleichen Zeit importierten die Engländer natürlich ihre eigene Musik. Aber nicht nur. Insbesondere die religiösen Werke von Händel waren in England sehr beliebt und wurden auch in Amerika aufgeführt. Billings, der ein großer Bewunderer von Händel war, fand allerdings, dass seine Musik nichts mit den Amerikanern zu tun hatte, da sie aus einem ganz anderen Kulturkreis herkam. Amerikaner sind direkt und deutlich, und so müsste auch ihre musikalische Sprache sein. Und diese direkte amerikanische Sprache kann man sehr gut in Bernsteins ‘Simple Songs’ und in vielen Werken von Copland heraushören. Dieses Ideal des Direkten und Deutlichen findet man quer durch die amerikanische Kultur, ob es sich nun um Musik handelt, um die Handwerkskunst oder um die genähten Steppdecken der Amischen. Und dieses Ideal ist tief in der Natur des Amerikaners verwurzelt. Irgendwie ist es so, dass wir amerikanische Komponisten, die sich an dem eleganten europäischen Kompositionsstil orientieren, zwar respektieren, wirklich schätzen tun wir aber jene, deren musikalische Sprache diese typische Direktheit besitzt, die aus dem Bauch kommt und genau dem Moment, in dem sie geschrieben wurde, entspricht.
Und wie steht es in dieser Hinsicht mit dem Komponisten Michael Tilson Thomas?
Mein Werdegang als Komponist hat schon als Kind begonnen, als ich auf dem Klavier improvisierte und meine eigene Musik spielte. Später hatte ich sehr engen Kontakt zur damaligen Avantgarde und ich versuchte, Musik zu schreiben, die diesem Stil damals entsprach. Heute sehe ich das nicht mehr so eng und entwickele mich gerne in verschiedene Richtungen. Momentan bin ich dabei, ein Werk zu beenden, an dem ich einige Jahre gearbeitet habe und das im Frühjahr des nächsten Jahres uraufgeführt wird.
Wo finden Sie nach einer so langen Karriere als Dirigent heute noch die Herausforderungen?
Eigentlich habe ich mich nicht viel verändert. Ich bin in all den Jahren immer der Gleiche geblieben. Meine Ansichten über das Leben, mein Idealismus, meine Freude, mit Leuten so zusammenzuarbeiten dass es wirklich eine Zusammenarbeit ist, dies sind Charakterzüge, die ich seit eigentlich schon immer hatte und die sich im Laufe der Jahre auch nicht wesentlich geändert haben. Neulich habe ich seit langem wieder das ‘Los Angeles Philharmonic’ dirigiert. Unter den Musikern gab es noch welche, die schon im Orchester gespielt haben, als ich dort mein erstes Konzert mit zwanzig Jahren gegeben hatte, also vor fünfzig Jahren, einem halben Jahrhundert. Nach dem Konzert sagten sie: « Michael ist noch immer der Gleiche. Seine Art zu arbeiten ist unverändert. Nur, dass er heute viel fokussierter arbeitet und viel tiefer in die Musik eindringt.“