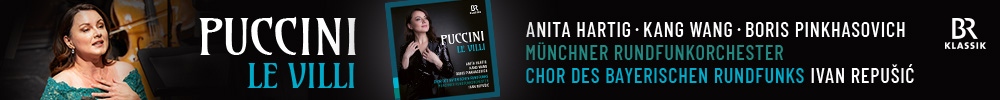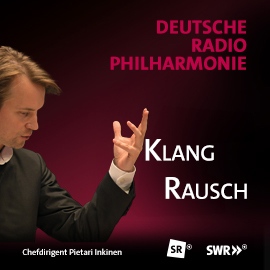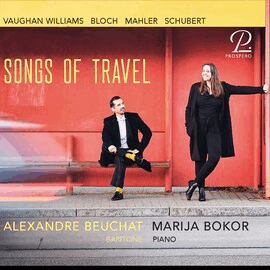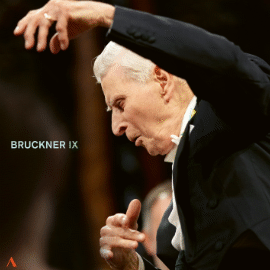Im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien gaben die Wiener Philharmoniker ihr jüngstes Konzert mit einem Brahms Programm. Als Gäste boten der Geiger Augustin Hadelich und der Cellist Gautier Capucon die Soli im Doppelkonzert. Dirigent auch für die 4. Symphonie war Christian Thielemann. Wie diese Riege namhafter Musiker die beiden Werke bewältigte, hat Uwe Krusch für Pizzicato miterleben dürfen.
Mit konzentrierter Hingabe widmeten sich alle Beteiligten vom ersten Ton dem Konzert für Violine, Cello und Orchester, der letzten großen Orchesterkomposition von Brahms. Die lange Orchestereinleitung bis zum Einsatz der Solisten stellte für das Publikum nicht als Geduldsprobe dar, da das Orchester unter der Leitung von Christian Thielemann diese schon aller Sorgfalt und Intensität darreichten. Mit seinem Einsatz zeigte Gautier Capucon als genauso sorgfältig wie reich im Klang und sonor aufspielenden Vertreter seines Instruments. Dem folgte Augustin Hadelich mit einem silbrigen leichten Ansatz, der bis auf einige Lagenwechsel mit nicht erforderlichem Glissando einen ebenso ausdrucksstarken wie feinsinnigen Instrumentalisten zeigte. Beide Solisten machten in ihrem Zusammenwirken hochgradig den kammermusikalischen Aufbau des Werkes deutlich. Dabei entstand in der Eindruck einer Bevorzugung der Cellostimme mit den schöneren und größeren Kantilenen. Sowohl abwechselnd wie auch im gemeinsamen Spiel zeigten beide Künstler ihr exzellentes spielerisches Können. Sie entwickelten Farben, formten die Agogik und die Dynamik mit Charme und Detailfreude. Mit der überzeugenden, bestens aufeinander abgestimmten Interpretation des Werkes boten sie eine an Übereinstimmungen so reiche Herangehensweise, so dass die beiden Solisten zusammen ein Mehr aus dem Werk herausholten.
Das Orchester durfte nach der Einleitung auch den kammermusikalischen Weg mittragen. So hatte Brahms dessen Rolle im letzten Satz auf nur 60 der 340 Takte beschränkt, so dass es bei Einwürfen bleiben musste. Thielemann achtete aber darauf, dass diese wenigen Beiträge mit aller Sensibilität und auch gestalterischen Freude und Kräfte beigesteuert wurden.
Der enthusiastische Beifall wurde von den beiden Solisten mit dem Ungarischen Tanz Nr. 5 in fis-Moll, natürlich von Johannes Brahms, in einer Fassung für Geige und Cello belohnt. Mit einem Höchstmaß an virtuoser Strahlkraft und spielerischem Esprit servierten sie diese Preziose.
Es schloss sich noch die 4. Symphonie an. Allein auf sich gestellt konnte das Orchester alle seine immensen Qualitäten zeigen. Dazu gehörte, dass sie zusammen mit dem Dirigenten dem zumindest in den Ecksätzen als schwierig eingeschätzten Werk so viel detailreiche Gestaltung angedeihen ließen, dass der Zuhörer einen reichen Strauß an Feinheiten hören konnte. Dabei führte Thielemann das Orchester aber so stringend durch die Symphonie, ohne deswegen ein drängendes Tempo zu verlangen, dass die Musik in einem anregenden Fluss ihre mächtige Wirkung entfalten konnte. Das Höchstmaß an gestalterischer Feinheit brachte der langsame Satz, das Andante moderato. Hier brachten Dirigent und Ensemble die Musik so beredt wie einfühlsam und doch mit derartiger Prägung und instrumental gepflegtem Spiel zu Gehör, dass es ein einziger Genuss wurde.