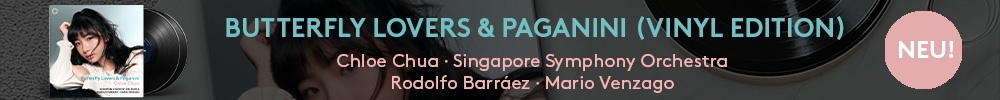Eine Märchenoper zu inszenieren bietet noch mehr Fallstricke an als es bei einer anderen Oper schon der Fall ist. Macht man es zu grell, sollte man besser die Regie zu einem Film versuchen. Macht man es zu abgründig, fühlt sich das Publikum vielleicht auf dem Sofa beim Psychiater. Schon 2009 hat Marie Still ihre Inszenierung geschaffen, die letztes Jahr wieder auf dem Spielplan stand und immer noch jung und frisch wirkt, ja sogar rundum überzeugend.
Still umschifft diese Gefahren, indem sie es vermeidet, unter der märchenhaften Oberfläche zu kratzen. Sie entscheidet sich für eine minimalistische Ästhetik mit düsteren Farben, wobei sie nur mit den langen, zappelnden Fischschwänzen von Rusalkas Schwestern Zugeständnisse an den Zauber dieser Oper macht, das aber überwältigend. Man mag dieses, in gewisser Weise, Fehlen von Interpretation bemängeln. Dafür schafft Still viele Details, mitunter auch deftige, die ihren Charme entfalten. So erheischt Rusalka die Aufmerksamkeit des Prinzen, indem sie ihren Schlüpfer fallen lässt und ihm in den Schritt fasst. Und auch der Auftritt der Holznymphen und von Vodnik ist deutlich sexuell konnotiert. Gleich zu Beginn sind sie so sinnlich wie betrunkene Karaoke-Sängerinnen am Wochenende und furchteinflößender. Wirklich märchenhaft gelingen die schwimmenden Schwestern von Rusalka. Anstelle eines Aquariums, wie es Sasha Waltz bei Dido und Aeneas vorgeführt hat, nutzt Still die volle Höhe des Bühnenraums und lässt sie von oben einschweben, wobei sich plötzlich etliche Meter lange Schwänze entfalten. Das sind keine gewöhnlichen Meerjungfrauen, sondern halb Frauen, halb Teichpflanzen. Oder sie nutzt die Technik des Schwarzen Theaters, etwa, um eine weiß gekleidete Tänzerin mit einer exquisiten Choreographie auf der Bühne auftauchen zu lassen. Die Ankunft von Vodnik, Rusalkas Vater im zweiten Akt, den nur Rusalka sehen kann, symbolisiert sie, indem sie die Handlung für einen Moment einfriert und mit subtilen Scheinwerfereffekten würzt, während dann die Feier im Hintergrund weitergeht. Man könnte noch etliche solche Beispiele anführen, aber das würde hier den Rahmen überdehnen.
Zu Handlung und Position in Dvoraks Schaffen verweise ich auf die Rezension zur Aufnahme aus Bromberg.
Robin Ticciati und das London Philharmonic Orchestra beleuchten die Partitur anschaulich. Beispielsweise das wiederholte Harfenmotiv erklingt klar und deutlich. Mit üppigen und schön phrasieren Streichern, überzeugenden Linien und Phrasierungen der Holzbläser sowie tadellos sicher bei den Tempi und Akzentuierungen wird die Partitur in Töne umgesetzt. Die Herbheit, die lyrische Schönheit und den schieren Zauber dieser Musik bringen sie zum Vorschein. Was sie nicht schaffen, ist zwischen Orchester und Stimmen auszubalancieren. Gerade vor dem Hintergrund, dass das Bühnenbild eben keinen Hintergrund bietet, um den Sängern zu helfen. Darunter leiden fast alle, auch die, die eine große Stimme haben,
Sally Matthews wächst von ihrer Silbermondarie über die quälende Stille des Hochzeitsfestes bis hin zum lyrischen Schluss. Sie zeigt sich als dramatische Sopranistin mit starker Stimme, ist kontrolliert und demonstriert überzeugende Bühnenpräsenz. Aber vielleicht zu viel, ihr weltlicher Sopran mit entwickeltem Vibrato überdeckt ihre Unschuld als Nymphe. Ihr Prinz, der amerikanische Tenor Evan LeRoy Johnson, ist kaum weniger beeindruckend und ihr ebenbürtig in der lyrischen Qualität. Er hat sowohl Bühnenpräsenz als auch viel stimmliche Kraft. Ihr abschließendes Duett, das mit ihrem Todeskuss endet, ist ein wunderbar zarter, intimer Höhepunkt dieses eindringlichen Augenblicks.
Aber auch die anderen Besetzungen sind sowohl stimmlich als auch gestisch zu loben. Alexander Roslavets macht aus dem Vodnik eine sowohl furchterregend als auch großartig sympathische Figur. Leider fehlt ihm das Gewicht, um das Orchester zu überwinden. Colin Judson und Alex Le Saux, Wildhüter und Küchenmädchen, wissen ihre Rollen lebensnah zu füllen. Patricia Bardon gibt die Hexe Ježibaba vielleicht etwas zu sympathisch. Wie Sally Matthews in der Titelrolle kämpft Patricia Bardon vor allem am unteren Ende ihrer Stimmlage darum, gehört zu werden. Zoya Tsererina in der Rolle als persönliche Assistentin, pardon, fremde Fürstin, wirkt eher kalkuliert als liebenswert, so dass es bei den Nymphen nicht zu Eifersuchtsszenen kommen muss, nur der Prinz verfällt ihr. Ihr gelingt es, das Orchester zu durchschneiden und eine seidenstimmige Prinzessin voller Stil und Prahlerei zu zeichnen.
Eine besondere Erwähnung verdienen der Wildhüter und seine Nichte, Colin Judson und Alix Le Saux, deren komische Nebenepisoden sehr unterhaltsam sind. Ebenso Adam Marsden als der Jäger und die Holznymphen Vavu Mpofu, Anna Pennisi und Aljona Abramova ergänzen vollwertig das Ensemble. Auch der Chor ist ausgezeichnet und bringt Freude und Schwung in das einfache Leben im See und Pathos in die Ablehnung von Rusalka. In ihren Rollen als Waldnymphen, Hochzeitsgäste und Rusalki trägt er enorm zu der Naturatmosphäre bei.
Die Aufführung erhebt sich brillant zum großen emotionalen Höhepunkt, ein Liebestod von einer Kraft wie bei Wagner, wenn auch à la Dvořák koloriert. Die Kraft dieses Endes ist erstaunlich bei einem Komponisten, der keinen großen Ruf für sein Opernschaffen genießt. Trotz einiger Anmerkungen bleibt ein durch und durch fesselnder Eindruck, der die Bewertung trägt.