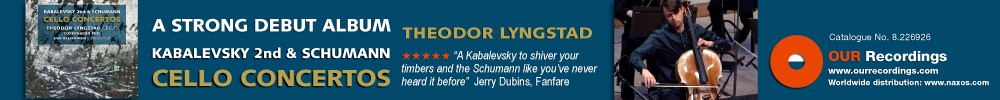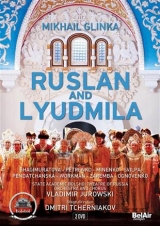Tcherniakov wäre nicht Tcherniakov, wenn es ihm nicht widerstünde, eine Oper zeit- und stilgetreu zu inszenieren. Jetzt hat er mit seinen abstrusen Einfällen Glinkas ‘Ruslan und Ludmilla’ verdorben. Es beginnt noch alles ganz stilgetreu mit einer typischen Hochzeit in der russischen Aristokratie, aber schon als plötzlich ein Kameramann über die Bühne geistert und seine Bilder auf der Rückwand des Hochzeitsaales projiziert werden, schwant dem Zuschauer Böses.
Zu Recht, denn was folgt, ist zeitlich in anderen und immer wieder verschiedenen Epochen angesiedelt, so dass sich dem Zuschauer ein höchst inkohärentes Bild bietet, das die Handlung durch die Zeitmaschine jagt, ohne Zusammenhänge zu kreieren.
Angeblich ging es dem Regisseur darum, die Modernität des Sujets und die Tiefe der Gefühle der handelnden Personen zu zeigen. Als ob Liebe etwas spezifisch Modernes wäre! Das wiederlegt Tcherniakov sogar selber mit seinen Zeitsprüngen, in denen offenbar wird, dass die Liebe zeitlos ist. Und in der im Grunde doch märchenhaften Handlung gelingt es ihm nicht, sich auf die Tiefe der Gefühle zu konzentrieren, denn das verwehrt ihm Glinka mit seinen Chören, die intime Szenen quasi unmöglich machen.
Musikalisch ist das Ganze hochkarätig: durchwegs gute Stimmen, ein sorgfältig gestaltender Dirigent und ein gutes Chor- und Orchesterensemble bieten beste Bolschoi-Qualität. Irgendwann im Lauf der 197 Minuten dauernden Aufführung habe ich das Bild weggeschaltet und mir die Oper ohne Tcherniakovs visuellen Unrat angehört.