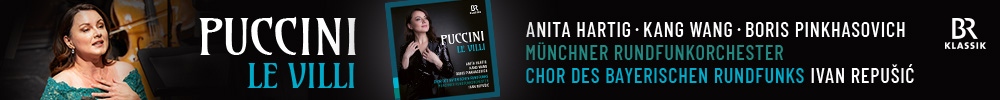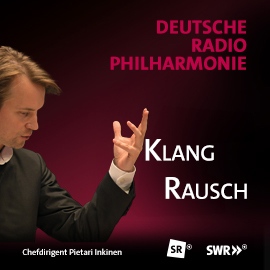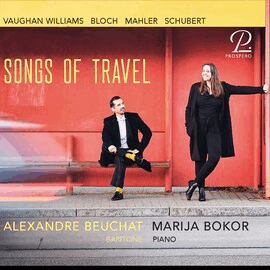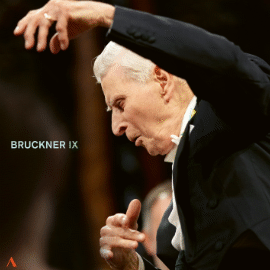Wenn drei als herausragende Solisten bekannte Künstler zum Klaviertrio zusammen finden, könnte man an zwei Fragen denken: Die generelle war, wie die oftmals in dieser Besetzung schwierige Balance zwischen dem Klavier und den Streichern gelang. Die spezifischere war die auf diese Besetzung bezogene Frage, ob die Drei musikalisch zueinander gefunden hatten und ein Mehr boten und nicht nur die Summe. Uwe Krusch hat Antworten.
Die drei Musiker waren die Geigerin Isabelle Faust, die Cellistin Sol Gabetta und Kristian Bezuidenhout an den Tasten. Sie hatten zwei in jedem Sinne große Werke eingeübt, zunächst von Ludwig van Beethoven das B-Dur Klaviertrio op. 97, das unter dem Namen Erzherzog-Trio bekannt ist. Dazu gesellte sich das Es-Dur Trio D 929 von Franz Schubert, 16 Jahre später 1827 entstanden. Ergänzend boten sie dann als Zugabe den 2. Satz, Adagio, aus dem Klaviertrio B-Dur op. 11, dem Gassenhauer-Trio, wiederum von Beethoven an.
Beethoven widmete viele seiner Werke Personen des Wiener Hochadels. Einer dieser besonders geschätzten Gönner war Erzherzog Rudolph. Dieser sehr menschliche und hochmusikalische Habsburger war dem Komponisten in tiefer Freundschaft verbunden. Neben dem B-Dur Trio dedizierte der Maestro ihm so bedeutende Werke wie das 4. und das 5. Klavierkonzert, die Klaviersonate Opus 111 und die “Missa solemnis”. Für das Trio hatte Beethoven Besonderes im Sinn. Auf dieses Kammermusikwerk übertrug er die Dimensionen und die gesangliche Aura seiner neueren sinfonischen Stücke.
Die Instrumentalisten leiteten das unbekümmert vor sich hinsingende Hauptthema des Kopfsatzes ein, wie es sich Beethoven vorgestellt hatte. In der Überleitung ließ Bezuidenhout im Klavierpart noch einmal kurz Beethovens triumphale Schreibweise aufleuchten, Dann aber widmeten sie sich rasch dem lyrischen Seitenthema. In diesem Abschnitt ließen sie eine Art Serenade aus der Pizzicato-Passage zu gitarrenartigem Klavierklang entstehen. Erst in der Coda formulierten sie die längst erwartete hymnische Steigerung des Themas im so typischen drängenden Gestus.
Das folgende Scherzo eröffnete Sol Gabetta, charmant mit einer naiv volkstümlichen Weise, die Isabelle Faust in einer Gegenbewegung beantwortete. Zwanglos stimmte das Klavier ein. Geradezu mit Vergnügen entwickelten sie den Weg des so einfachen Themas, so unscheinbar es auch scheinen mochte. Beethoven zeichnete sich hier als Meister des Kontrapunkts ebenso aus wie als musikalischer Zeitzeuge mit seinem ironischen Kommentar zur Walzersucht der Wiener. Mit der humoristisch gefärbten Coda stellten die Interpreten den Frohsinn wieder her.
Mit dem Andante cantabile präsentierten die Drei einen der schönsten Variationensätze in Beethovens Kammermusik. Der Gefahr eines zu langsamen Tempos ausweichend, stellten sie im Laufe der Variationen den Klang in den Vordergrund. Die sperrige Gestalt nutzten sie, um die späten Quartette ahnen zu lassen. In der vierten Variation mit synkopiertem Thema in den Streichern über rauschenden Klavierakkorden ließen sie klassische Klangschönheit singen.
Den unversehens einsetzen Finalsatz überforderten sie nicht und ließen den tändelnden Charakter, der in der leichten Behandlung der drei Instrumente anschaulich hervortritt, zu. Die folgende, teils humorvolle, teils widerborstige Handhabung wussten sie mit Augenzwinkern zu heben. Auch den weiten harmonischen Weg zur Grundtonart entwickelten sie in ebenso sensitiver wie gestalterisch miteinander verschmolzen, so dass sie diesen Satz bzw. das Werk edel abschlossen.
So durfte man nach dem Beethoven Trio die Frage nach dem Mehr dem gemeinsamen Spiel der drei Beteiligten vollauf bejahen. Zwar war am Ende auch eine Stimme aus dem Publikum zu hören, die den Unterschied zu einem jahrelang zusammenspielenden Trio bemerkt zu haben meinte und wohl die am Abend zu hörende gelegentliche Kombination als negativ wertete. Doch kann ich diesen Eindruck nicht bestätigen. Vielmehr erlaubten sich die beiden Damen und der Herr eine große Gestaltungsintensität und Bereitschaft zu ausgeklügelter, manchmal durchaus auch pointierter Beleuchtung des gespielten Notentextes, die ein ständiges Trio vielleicht nicht zeigen würde. Aber diese Möglichkeiten der Ausformung wurden durch erlesenes Spiel und ausgefeilte Deutungsart ermöglicht und nicht durch schaustellerische Praktiken, die von diesen Künstlern auch nicht zu erwarten waren.
Auch die Frage der Balance gelang in einer sehr gelungenen Weise. Bezuidenhout hatte als Instrument ein Hammerklavier zur Verfügung, so dass insbesondere von dieser Seite eine Tongebung im Sinne der Entstehungszeit der Werke gezeigt wurde, die dem Klavier alle Freiheiten gestattete, ohne die Streicher auch nur im Entferntesten einzuschränken oder gar zu überdecken.
Nach Beethovens Opus 97 schuf erst wieder Franz Schubert mit seinem Es-Dur-Werk einen Gattungsbeitrag von solchem Format. Auch dieses Nonplusultra romantischer Kammermusik mit dem starken Bezug zur Winterreise wussten die drei Musiker überwältigend darzubieten. Das für Schubert ungewöhnlich knappe und energische Hauptthema führte die Musik fast in Beethovenscher Manier weiter. Die Interpreten bauten das dritte, gesangliche Thema des Kopfsatzes in großen Blöcken aus weiträumigen Motivsequenzen auf. Das melancholische Mollthema des Folgesatzes kostete Gabetta zu Beginn über den eisigen Staccatoakkorden des Klaviers aus. Die sanften Oktavsprünge des zweiten Themas markierten sie jedoch bald als aggressiv fordernde Gesten in immer kraftvolleren Steigerungen bis zurück zum Hauptthema, das angstvoll gesteigert erklang. Das spielerisch gelöste Scherzando und das monumentale Finale mit den beiden Themen kontrastieren in Tonart, Charakter und auch der Taktakt, was Faust, Gabetta und Bezuidenhout kunstvoll auskosteten.
Danach kosteten die Zuhörer den Applaus lange und begeistert aus, der mit der genannten Zugabe belohnt wurde.